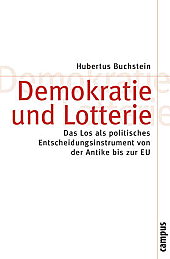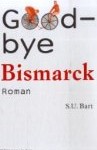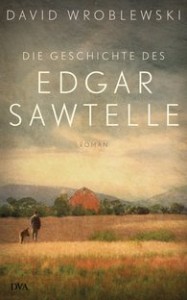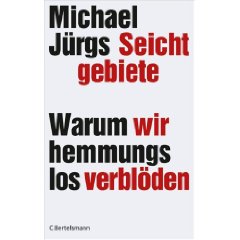
Wer hat das nicht schon einmal erlebt? Man trifft auf einer Party einen Zeitgenossen, mit dem man sofort in vielen Punkten gleicher Meinung ist. Andere kommen hinzu und nehmen in der Debatte teilweise konträre Positionen ein. Man verteidigt den Angegriffenen. Und plötzlich holt dieser zu verbalen Rundumschlägen aus, verlässt das scheinbar so fruchtlose Argumentieren, beschimpft die Mitdiskutanten rüde und wundert sich am Ende, das niemand seine Sicht der Dinge teilt, was dann zur Bestätigung der These herangezogen wird, dass alle anderen eh’ zu blöde sind. Achselzuckend geht die Runde auseinander und mit den Schimpfkanonaden des Beleidigers ist der Kern der eigenen Überzeugung auch gleich ein bisschen mitdiskreditiert worden.
Der Volksmund hat dieses Dilemma im Sprichwort vom Ton, der die Musik macht, festgehalten. Und mehr denn je gelten im Diskurs bestimmte Gebote, die ihn überhaupt erst ermöglichen. Das bedeutsamste ist die gegenseitige Akzeptanz. Ohne das gegenseitige Anerkennen ist ein Diskurs undurchführbar. Die Regeln dieses respektvollen Diskutierens, die zunächst im informellen Gebrauch geformt werden und dann allgemeine Gültigkeit durch Gebrauch erhalten, sind in den letzten Jahrzehnten immer präziser und teilweise durchaus repressiver geworden. Zudem wurden inzwischen institutionell verankerte und sanktionierte Ge- bzw. Verbote ausgesprochen. Viele sehen daher in öffentlichen Diskussionen inzwischen immer mehr übertriebene Korrektheiten, die formale Elemente dem argumentativen Austausch unterordnen. Die Folge seien, so die These, häufig blutleere Beiträge, die sich mitunter in elaborierter Wortgymnastik ergehen.