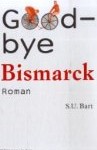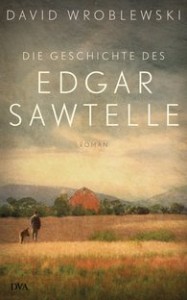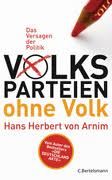»Die übergreifende Verbindungslinie von 1871 und 1990, also von nationaler Vereinigung und Wiedervereinigung, fand schließlich in Hamburg ihren sinnfälligen Ausdruck in Form eines ephemeren Denkmals besonderer Art: Ein ‘Kommando Heiner Geißler’ aus der autonom-alternativen Szene hatte des Nachts dem Bismarck-Denkmal von Lederer einen Helmut Kohl-Kopf übergestülpt und so die deutschen Einigungskanzler zur historischer Einheit verschmolzen.« Dieses Zitat stammt aus dem Aufsatz »Truppentriumph und Kaiserkult – Ephemere Inszenierungen in Hamburg« von Roland Jaeger aus dem Buch »Mo(nu)mente« (herausgegeben von Michael Diers). Jaeger nimmt Bezug auf ein wahres Ereignis: tatsächlich wurde anlässlich der Vereinigungsfeiern am 3. Oktober 1990 dem Kopf Bismarcks eine Helmut Kohl-Maske übergestülpt.
Zweifellos ein Husarenstück (das Denkmal ist über 30 Meter hoch!), hier verstanden als kurzlebiges Kunstobjekt mit politischer Intention. Es ist die Grundlage für Stephanie Barts Roman »Goodbye Bismarck« (nun ja, der Nachklang zu »Goodbye Lenin« ist wohl durchaus gewollt). Klugerweise weist die Autorin (die S. U. Bart genannt werden möchte) am Anfang darauf hin, dass es sich zwar um »nackte, sauber recherchierte Tatsachen« handele von denen sie jedoch »manche mit Macht und Bedacht verdreht habe«. Und glücklicherweise sind wohl einige »Erfindungen« darunter, »die weder mit den Wahrheiten noch mit den Wirklichkeiten von damals irgendetwas zu tun haben«.Weiterlesen