Dieter Wedel hat einen Film über die »Gier« gemacht. Über Finanzjongleure, die Anlegern sagenhafte Renditen versprechen. Wobei die meisten dieser Anleger den Unterschied zwischen Rendite und Gewinn noch nicht einmal so genau kennen, weshalb man die vereinfachende Formulierung »Faktor« verwendet. »Faktor 13« bedeutet, dass man das 13fache des »eingesetzten« Geldes zurückbekommen soll. Bei dieser Art Versprechen fragt offensichtlich niemand, wie dies geschehen soll. Die Antizipation des erwartenden Gewinns genügt zuerst einmal.
Tariq Ramadan: Muhammad
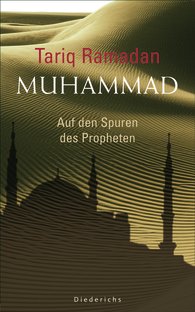
‘O ihr, die den Glauben ablehnt, [deren Herzen verschleiert sind!] Ich verehre nicht, was ihr verehrt, noch verehrt ihr, was ich verehre! Ich bin kein Verehrer dessen was ihr verehrt, noch seid ihr Verehrer dessen, was ich verehre. Euch eure Religion, und mir meine Religion.’
Als ich das erste Mal davon hörte, dass Pier Paolo Pasolini einen Film über das Matthäusevangelium gemacht hatte, dachte ich, dass dieser Film wohl ein Riesenskandal gewesen sein muss. Schließlich war Pasolini Kommunist, Nonkonformist und vor allem: Atheist. Von seiner Homosexualität, die in vielen europäischen Ländern damals noch ganz offiziell als Verbrechen galt und noch heute von der katholischen Kirche verteufelt wird, ganz zu schweigen. Aber als ich dann zum ersten Mal den Film sah, war ich überrascht. Und verzaubert.
Der Film ist von 1964. Gedreht mit Laienschauspielern und in schwarz-weiß. Nichts wurde hier hinzugefügt; es ging tatsächlich um »Werktreue«. Suggestive Bildsprache und Musik erzeugten eine Stimmung, die einem plötzlich die Chance bot, all dies für wahr zu halten. So auch das naturgemäß schwer zu glaubende Ende. Der intellektuell-korrekte Ausweg einer nur metaphorisch zu verstehenden Auferstehung war plötzlich eine allzu banale Ausrede, der den Zauber dieses Films, dieser Situation, dieser Konstellation mutwillig zerstört hätte. Und so reduzierte Pasolini Jesus von Nazareth nicht auf die Rolle eines Sozialrevolutionärs (diese Sicht gab es freilich auch), sondern zeigte dessen Spiritualität als Gewissheit. Das brachte ihm einiges Unverständnis ein, weil sich viele von Pasolini eine »radikalere« Sichtweise wünschten. Aber radikaler konnte es gar nicht sein, es war nur nicht die »erwartete« Radikalität (sprich: Gegnerschaft). Die Gretchenfrage lautete: War Pasolini wirklich ein Atheist? Die ästhetische Antwort wäre: Was spielt das für eine Rolle?
Matthias Horx: Das Buch des Wandels

Das Pseudonym von Matthias Horx in »World of Warcraft« lautet Heilpriester Planetarius. Als man das ungefähr in der Mitte des Buches erfährt, ist man nicht mehr sonderlich überrascht. Hier ist jemand, der nach langer (und suggestiver) Rede mit forschem Gestus und angelsächsisch angehauchtem Optimismus seinem Leser auf die Schulter klopft und »alles Gute« wünscht. Lässt man sich auf sein »Buch des Wandels« ein, bleibt man zuverlässig von den großen Katastrophen verschont. Fast nebenbei soll sich beim Leser das wohlige Gefühl einstellen, Zigtausende Seiten Lektüre gespart zu haben. Nachfrager, Abwäger, Skeptiker, Kritiker – sie gehören allesamt der Gruppe der Alarmisten an. Das hat man endlich schwarz auf weiß. Daneben gibt es noch die mehr oder weniger gleichgültigen Stoiker und, nachdem diese Zweiklassengesellschaft wider Erwarten doch nicht ausreicht, kommen noch die Wandelhektiker à la Sloterdijk dazu, die nur mit Imperativen agieren und reglementieren können. Ein schöner Beleg dafür, dass Horx Sloterdijks Buch nicht verstanden hat. Aber wenn es nur das wäre…
Oscar Heym: Die Reserven
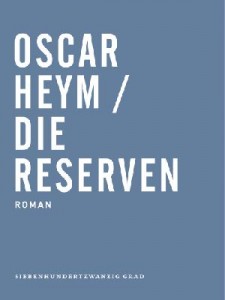
Deutschland 1976, mitten im »Kalten Krieg«. Die Ölkrise ist zwar vorüber (die Sonntagsfahrverbote wurden im Dezember 1973 aufgehoben), aber der Schock sitzt tief. Wenzel Hoffmann, deutsch-amerikanischer Geologe kommt nach Deutschland, um in halb-geheimer Mission nach Öl zu bohren. Er wacht aus dem Flug aus bleierner Müdigkeit auf und stellt fest, dass seine Unterlagen verschwunden sind. Er rennt zurück zum Flieger, trifft dort aber nur einen alten Mann, der ihn kurz an seinen Vater erinnert, und die attraktive Stewardess Margarethe (Mag). Beide können ihm nicht helfen; die Unterlagen bleiben unauffindbar. Mag und Wenzel verbringen entgegen jeder Planung mehrere Tage zusammen und geben sich hemmungslosem Sex hin.
Wie ein kleiner Taugenichts wird dieser Wenzel eingeführt, der mit mehreren Tagen Verspätung in dem fiktiven (?) Ort Gronau im deutsch-deutschen Grenzgebiet eintrifft (das reale Gronau-Leine stimmt geografisch nicht ganz mit dem Erzählort überein; allerdings gibt es tatsächlich Erdölvorkommen in Niedersachsen die gefördert werden).
Odessa Transfer – Nachrichten vom Schwarzen Meer (Hrsg.: Katharina Raabe und Monika Sznajderman)
 In »Odessa Transfer« begibt man sich in dreizehn Etappen auf eine Reise rund um das Schwarze Meer, wobei, wie Katharina Raabe als Mitherausgeberin dieses Buches im Vorwort feststellt, viele Beiträge härter und politischer ausgefallen seien, als man dies erwartet hatte. Und der Leser schnauft mitunter über diesen tatsächlich verbissenen politischen Impetus, der einige dieser Erzählungen, Essays und Reportagen (es gibt auch ein Gedicht – und was für eines!) bestimmt und muss dabei wohl konstatieren, dass diese Region vorerst leider keine Postkartenidylle ist, in der zwanzig Jahre nach Aufhebung der bipolaren Welt per Knopfdruck paradiesische Zustände eingetreten sind.
In »Odessa Transfer« begibt man sich in dreizehn Etappen auf eine Reise rund um das Schwarze Meer, wobei, wie Katharina Raabe als Mitherausgeberin dieses Buches im Vorwort feststellt, viele Beiträge härter und politischer ausgefallen seien, als man dies erwartet hatte. Und der Leser schnauft mitunter über diesen tatsächlich verbissenen politischen Impetus, der einige dieser Erzählungen, Essays und Reportagen (es gibt auch ein Gedicht – und was für eines!) bestimmt und muss dabei wohl konstatieren, dass diese Region vorerst leider keine Postkartenidylle ist, in der zwanzig Jahre nach Aufhebung der bipolaren Welt per Knopfdruck paradiesische Zustände eingetreten sind.
Es beginnt mit Aka Morchiladzes wunderbarer Ortserzählung über die georgisch-türkische Grenzstadt Batumi, welche den Schatz der Ewigkeit besitzt und immer auch nach Flucht riecht und dem Autor gelingt es auf diesen noch nicht einmal zwanzig Seiten fast die ganze Geschichte vom 15. Jahrhundert über Stalin bis in die Gegenwart dieses Ortes zu evozieren und auf die Frage, was wohl das Schönste an Batumi sei, gibt es diese kleine Eloge (und für einen Moment möchte man sofort dort hin):
Der Lügner
Norbert Lammert scheint Standpauken zu lieben. Als sich der neue Bundestag konstituierte, beschimpfte er die öffentlich-rechtlichen Medien, diese Veranstaltung in den Spartenkanälen zu verstecken. Da hatte er nicht ganz unrecht, auch wenn diese Schelte ein bisschen Ablenkungsmanöver war – sitzen noch in den Gremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten genug Politiker.
Jetzt hat sich Norbert Lammert wieder zu Wort gemeldet. Er tadelt das Auftreten der Regierung und insbesondere das sogenannte »Wachstumsbeschleunigungsgesetz«, in dem unter anderem der Umsatzsteuersatz für Hotels gesenkt wurde. Auch hier stimmen ihm sicherlich viele zu.
Ludwig Wittgenstein:
Man hat Recht, sich vor den Geistern auch großer Männer zu fürchten. Und auch vor denen guter Menschen. Denn was bei ihm Heil gewirkt hat, kann bei mir Unheil wirken. Denn der Geist ohne den Menschen ist nicht gut – noch schlecht. In mir aber kann er ein übler Geist sein. Ludwig Wittgenstein »Denkbewegungen«, Tagebücher ...
Thomas Bernhard – Siegfried Unseld: Der Briefwechsel (Hrsg.: Raimund Fellinger, Martin Huber und Julia Ketterer)
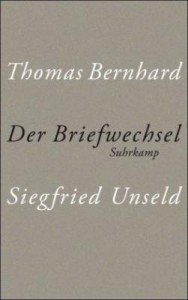 Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.
Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.
Nach mehr als 800 Seiten Korrespondenz des Briefwechsels zwischen Thomas Bernhard und seinem unzuverlässige[m] Verleger, dem Frankfurter Ungeheuer und Schauerkerl Siegfried Unseld (Diktatzeichen »dr. u.«), mag der Leser nicht mehr an einen Zufall glauben; allenfalls an einen Freudschen Verschreiber. Vielleicht ist dieses »f« unbewusste Vorwegnahme dieser unbändigen Lust an der Provokation, die Bernhard in unkalkulierbaren Schüben zu fast cholerischen Eruptionen treibt, die zu Beginn noch von seiner Lektorin Anneliese Boland befeuert werden: »Ein kurzer Ohlsdorfer Donner als Antwort auf den Blitz aus dem Frankfurter Himmel empfiehlt sich«. Sie signalisiert Bernhard »eigentlich kann das Match nur zu Ihren Gunsten ausgehen«) und dieser entwickelt schnell ein Gespür wie weit er mit seinen Forderungen, Klagen und Beschimpfungen gehen kann, ohne den Bogen zu überspannen.
