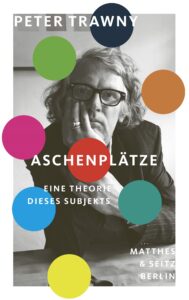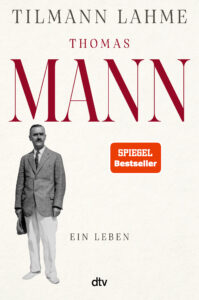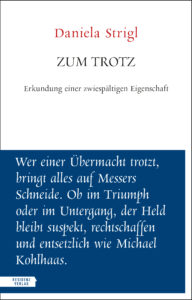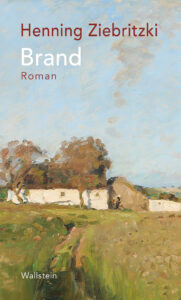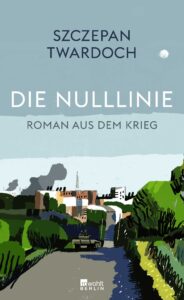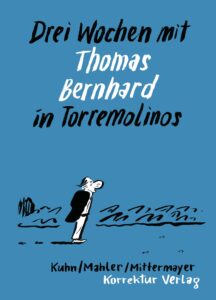
Am 27. November 1988, drei Wochen nach der skandalumtosten Premiere von Heldenplatz am Wiener Burgtheater (inszeniert vom unlängst verstorbenen Claus Peymann), flog Susanne Kuhn, geborene Fabjan, mit ihrem Halbbruder Thomas Bernhard nach Torremolinos. Von da aus ging es mit dem Taxi zum Hotel La Barracuda an die Costa del Sol. Der Rückflug für Susanne Kuhn war am 18. Dezember vorgesehen. Die genauen Reisedaten inklusive Preise kann man auf der abgedruckten Rechnung im soeben im Korrektur Verlag erschienenen Buch Drei Wochen mit Thomas Bernhard in Torremolinos nachlesen.
Es dauerte fast 37 Jahre bis Susanne Kuhn sich aufraffte zusammen mit dem Zeichner Nicolas Mahler und dem exzellenten Bernhard-Kenner und ‑Biografen Manfred Mittermayer dieses Erlebnis eine Form zu geben. Herausgekommen ist ein ehrlicher Text, der schnörkellos heitere und ärgerliche Momente beschreibt, illustriert in bekannter Manier von Nicolas Mahler (Thomas Bernhard mit ein bisschen an Loriot erinnernder Knollennase).Vermutlich wussten nur sehr wenige, wie krank Thomas Bernhard damals wirklich war. Er konnte z. B. nur noch im Sitzen schlafen; Susanne Kuhn musste ihm mit einer Schreibtischschublade im Rücken das Bett herrichten, damit das möglich war. Einmal konnte sie eine Atemnot Bernhards nur mit Nitroglycerin-Spray lindern. Warum diese Reise? Aus einem Bedürfnis, dem sehr kranken, aber auch immer etwas unnahbaren Bruder beizustehen? Susanne Kuhn war selber nicht gesund, hatte gerade ihre vorzeitige Rente durchbekommen, litt unter zahlreichen Ängsten und Phobien, wie etwa Flug- oder Platzangst. Als die beiden ihre Zimmer im 9. Stock zugewiesen bekommen, drängt sie für sich auf ein Zimmer auf der 2. oder maximal 3. Etage.
Da man sich noch nie derart nahe gekommen war, gab es besonders zu Beginn Spannungen und Missverständnisse. Etwa als der »passionierte Schuhkäufer« Bernhard mit ihr in ein Schuhgeschäft ging und dort auch zwei Paar Schuhe für sie kaufen wollte. Sie musste jedoch vor ihm wie auf einem Laufsteg immer wieder gehend überprüfen, ob sie auch wirklich passten. Kurz darauf erwog sie ernsthaft, vorzeitig abzureisen, blieb dann jedoch bis zum Schluss. Danach übernahm Peter Fabjan.
Es gibt auch anekdotisches vom leidenschaftlichen Überschriftenleser Thomas Bernhard (die Stöße der gekauften Zeitungen trug sie ihm hinterher). Beispielsweise über den eher unbefriedigenden Ausflug nach Gibraltar. Oder der Besuch von Jochen Jung (mit einer merkwürdigen Sitzordnung im Restaurant). Dann von Bernhards Freude mit ihr im Duett In the summertime zu singen. Oder die Schwester im 12 Grad kalten Hotelpool schwimmen zu sehen. Aus Sparsamkeitsgründen sollte sie einen öffentlichen Münzfernsprecher verwenden; das Telefon im Hotel war ihm zu teuer. Bernhard selber wartete auf einen Anruf von Siegfried Unseld. Der kam nicht. Was er wohl nicht wusste: Der war mit Peter Handke zur gleichen Zeit in Madrid.