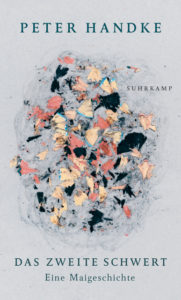
Das zweite Schwert
» ‘Das also ist das Gesicht eines Rächers!’ sagte ich zu mir, als ich mich an dem bewußten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah.«
Mit diesem Satz beginnt Peter Handkes Erzählung Das zweite Schwert, und als Leser könnte man nun annehmen, die im Untertitel versprochene »Maigeschichte« werde alsbald losgehen. Der entschlossene Gestus des Anfangens erinnert an bekannte Erzählwerk der Literaturgeschichte, wo der Autor gleich zu Beginn einige wichtige Mitteilungen über die Hauptfigur und die Situation macht, in der er sich befindet. »Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.« Tatsächlich geht diese Geschichte sogleich los, die beiden Schergen brechen in K.s Leben ein, doch bekanntlich verwickelt sich die Geschichte immer mehr, sie findet kein Ende, und wenn es eines gibt – Kafka hat es skizziert –, so weiß man nicht, wie die Erzählung dorthin gelangen kann. Der Roman ist Fragment geblieben.
Handke hat die Werke, die wir von ihm kennen, allesamt abgeschlossen, doch im Verlauf seines Schriftstellerlebens hat er die Direktheit mit der er in frühen Erzählungen in medias res ging, verloren oder bewußt abgelegt. Der Wechsel erfolgte in etwa zu der Zeit, in der Handke sich von Kafka als Vorbild lossagte. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter zum Beispiel beginnt so: »Dem Monteur Josef Bloch der früher ein bekannter Tormann gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, daß er entlassen sei.« Kompakte Syntax und viel (für notwendig gehaltene) Mitteilung, wie in den Geschichten Kleists. Unvermittelt erfahren wir Namen, Beruf, sportliche Aktivität und die Situation, in die sich der Held geworfen sieht. In einem späteren Werk, in dem Handke die Geschichte des »geglückten Tags« zu erzählen versucht, fragt sich der Erzähler selbst, weshalb er den eigentlichen Beginn immer wieder verschiebt.






