» ‘Das also ist das Gesicht eines Rächers!’ sagte ich zu mir, als ich mich an dem bewußten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah.«
Mit diesem Satz beginnt Peter Handkes Erzählung Das zweite Schwert, und als Leser könnte man nun annehmen, die im Untertitel versprochene »Maigeschichte« werde alsbald losgehen. Der entschlossene Gestus des Anfangens erinnert an bekannte Erzählwerk der Literaturgeschichte, wo der Autor gleich zu Beginn einige wichtige Mitteilungen über die Hauptfigur und die Situation macht, in der er sich befindet. »Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.« Tatsächlich geht diese Geschichte sogleich los, die beiden Schergen brechen in K.s Leben ein, doch bekanntlich verwickelt sich die Geschichte immer mehr, sie findet kein Ende, und wenn es eines gibt – Kafka hat es skizziert –, so weiß man nicht, wie die Erzählung dorthin gelangen kann. Der Roman ist Fragment geblieben.
Handke hat die Werke, die wir von ihm kennen, allesamt abgeschlossen, doch im Verlauf seines Schriftstellerlebens hat er die Direktheit mit der er in frühen Erzählungen in medias res ging, verloren oder bewußt abgelegt. Der Wechsel erfolgte in etwa zu der Zeit, in der Handke sich von Kafka als Vorbild lossagte. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter zum Beispiel beginnt so: »Dem Monteur Josef Bloch der früher ein bekannter Tormann gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, daß er entlassen sei.« Kompakte Syntax und viel (für notwendig gehaltene) Mitteilung, wie in den Geschichten Kleists. Unvermittelt erfahren wir Namen, Beruf, sportliche Aktivität und die Situation, in die sich der Held geworfen sieht. In einem späteren Werk, in dem Handke die Geschichte des »geglückten Tags« zu erzählen versucht, fragt sich der Erzähler selbst, weshalb er den eigentlichen Beginn immer wieder verschiebt.
»Und wo bleibt, bei deinen ständigen Abschweifungen, Umwegen, Umständlichkeiten, deinem ewigen Zögern, Abbrechen sofort mit dem kleinsten anhebenden Schwung, ewigen Neuanfängen, jene Linie der Schönheit und Anmut« – William Hogarths line of beauty and grace, die der Schreibende erklärtermaßen auf seine Weise ziehen möchte – »welche, wie angedeutet, den geglückten Tag bezeichnet, und, wie danach beschworen, auch den Versuch darüber leiten sollte? Wann, anstelle des unentschiedenen Zickzacks draußen an den Peripherien, des zittrigen Grenzziehens an einer umso leerer wirkenden Sache, setzt du endlich, Satz für Satz, zu dem so leicht-wie-scharfen Schnitt, durch das Wirrwarr in medias res, an, damit dein obskurer ‘geglückter Tag’ beginnen kann, sich zu der Allgemeinheit einer Form zu lichten?« Einstweilen bleibt es bei Ansätzen, bei Versuchen eben, erst im letzten Fünftel des Textes gibt es etwas wie eine – durchaus allgemeine, einzelne Tage verallgemeinernde – Chronik des in Frage stehenden Tags. Ein Großteil der Erzählzeit vergeht mit allerlei Vorbereitungen und Selbstbefragungen hinsichtlich des Erzählens.
Verzögern tut sich also das Erzählen selbst, wie in anderen, epischen und entsprechend umfangreichen Werken die Handlung, beispielsweise eine so einfache wie das Besteigen eines demnächst abfahrenden Buses in Die morawische Nacht oder der Aufbruch zu einer regionalen Reise, auf welcher der Ich-Erzähler der weiblichen Hauptfigur nachspürt und die beide am Ende zu einer familiären Zusammenkunft führen wird, in Die Obstdiebin. Die kleinere Erzählung Das zweite Schwert wiederholt und variiert bereits mehrfach erschriebene Wege, das heißt immer auch: Erzählwege, in der Gegend der Niemandsbucht und ihrer weiteren Umgebung, diesmal als Ile de France benannt, mit der »Weltstadt« Paris inmitten, die hier freilich umgangen wird, und sie tut es in einer ähnlichen Bewegung des Schweifens wie zum Beispiel in Der Große Fall, wo es nicht um Rache geht, obwohl auch hier sich Mordgelüste melden, die auch hier letzten Endes in etwas anderes verwandelt werden, in eine Liebesbegegnung, die die Abkehr von der ursprünglichen Erzählintention erfolgreich vollendet.
Aber warum zögert der Erzähler? Aus Angst vor dem Mißlingen, wie der Dichter, der sich nicht getraut, die weiße Seite zu beflecken? Mag sein, daß das mitspielt, doch das Zögern gewinnt selbst erzählerische Bedeutung, indem das Rachestreben selbst nach und nach, ohne daß der Erzähler darüber reflektierte und den Leser aufmerksam machte, als zu besänftigender, in etwas anderes zu verwandelnder Impuls erkannt wird. Das Zögern ist im Fall von Das zweite Schwert ein Zögern vor der Rache, das die Gestalt eines mehr oder minder langen Wegs zu einem verschobenen Ziel gewinnt, wobei der Weg mit dem Ziel zusammenfällt, weil das Erzählen und Schreiben selbst eine Art sublimierter Rache ist. Was der Erzähler seiner Feindin antut, ist, daß er sie in der Erzählung nicht vorkommen läßt, also von ihr im Grunde genommen abgelassen hat. Die Besänftigung braucht ihren Weg; sie ist der Weg.
Das Wort, von Handke manchmal gebraucht, und zwar über die Jahrzehnte hinweg immer wieder, seit der Lehre der Sainte-Victoire, erinnert an Adalbert Stifters »Sanftes Gesetz«. In Der Große Fall hören wir einen Nachklang davon in der Erwähnung eines Films mit dem Titel Der sanfte Lauf, den es tatsächlich gibt: Es ist der erste Spielfilm, in dem Bruno Ganz die Hauptrolle spielte (der Verweis macht klar, daß Ganz das Vorbild »seines« Schauspielers, wie ihn der Erzähler nennt, ist – wiewohl Handke in der Figur wohl eher sich selbst porträtiert). In seinem vermutlich letzten Film soll der Schauspieler einen Amokläufer darstellen, doch er sträubt sich dagegen, wie er sich gegen seine eigenen aggressiven Impulse wehrt. Von der Großen Vernichtung zurück zum Sanften Gesetz, vom Amoklauf zum friedlich wahrnehmenden, scheinbar ziellosen Flanieren. Wie gesagt, dasselbe glissement, dieselbe unterschwellige Erzähldynamik, dieselbe Art der Verwandlung finden wir in Das zweite Schwert wieder.
Wie erzählt man die bloße Fortbewegung, die oft genug auch noch sehr langsam, weil zu Fuß stattfindet? Handkes Werke sind keine Reiseberichte, die Kunde aus der Fremde tun, eher ähneln sie Road Movies, wie Wim Wenders sie drehte (etwa schon Falsche Bewegung!), es sind Geschichten vom Unterwegssein und davor noch vom »sich auf den Weg machen«, von Aufbrüchen und Aufschwüngen, die auf Schwierigkeiten stoßen, die dann selbst zu Erzählfaktoren werden. On the road, ja, aber eher auf Pfaden, auf Um- und Abwegen, auf Nebenstraßen oder querfeldein. Im Gehen (und Fahren) nehmen die Figuren nicht nur ihre Umgebungen wahr, sie erzählen auch ihre Geschichte und erzählen sie sich selbst, wenigstens Teile davon, um sich mit sich zu verständigen. In Das zweite Schwert ist die Beziehung des Ich-Erzählers zu seiner Mutter, die einmal sogar als »heilige Mutter« bezeichnet wird, der zentrale Einsatz, das enjeu, obwohl nicht viel von ihr erzählt wird (das hat Handke schon in Wunschloses Unglück getan). Die Mutter ist schwer beleidigt, d. h. verleumdet worden, indem ihr nachgesagt wurde, sie habe 1938 beim Anschluß Österreichs an Deutschland in einer Menschenmenge Hitler zu gejubelt. Die Anekdote scheint sich auf die Inszenierung einer Bühnenfassung von Wunschloses Unglück im Kasino des Wiener Burgtheaters zu beziehen, bei der tatsächlich Handkes Mutter in einer Fotomontage in einer solchen Jubelmenge gezeigt wurde. Handke war damals, 2014, zurecht erzürnt, in der Fiktion hat er diesen Zorn jedoch in eine andere Richtung gelenkt, nämlich gegen den gängigen Journalismus. Die Beleidigerin ist im Zweiten Schwert eine Journalistin, und die beleidigte Mutter wird durch die Erzählung selbst gerächt, und nicht durch einen gewalttätigen Angriff auf die Beleidigerin – die Geschichte nimmt, wie gesagt, einen ganz anderen Verlauf. Dadurch, daß ihr Sohn ein weltberühmter Autor geworden ist, ist sie gerechtfertigt, obwohl ihr Leben frühzeitig und scheinbar unerfüllt abbrach (wenn wir uns an der Geschichte von Wunschloses Unglück orientieren und die beiden Figuren zusammensehen).
Die Beleidigung der Mutter des Ich-Erzählers in Das zweite Schwert muß lange nach deren Tod stattgefunden haben, denn vieles deutet darauf hin, daß er sich im fortgeschrittenen Alter befindet, nicht zuletzt die vielen Rückblicke und Anspielungen auf Werke und Titel der Schriftstellerlaufbahn des Peter Handke. Die Mutter dürfte also zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelebt haben, und zieht man die Biographie des Autors oder seine Mutter-Erzählung aus dem Jahr 1972 heran, so liegt ihr Tod Jahrzehnte zurück. Die Beleidigung fand nur in einem journalistischen Nebensatz statt, vermutlich eher eine Fahrlässigkeit der Verfasserin des Textes, die sich mit der Geschichte nicht so genau auseinandergesetzt haben dürfte. Sie hatte geschrieben, »meine Mutter sei eine der Millionen aus der einstigen großen ‘Donaumonarchie’ gewesen, für welche die Einverleibung des kleingewordenen Landes ins ‘Deutsche Reich’ Anlaß zu Freudenfesten gewesen sei; meine Mutter habe gejubelt, will sagen, sei eine Anhängerin, eine Parteigenossin gewesen.« Die Biographie Handkes und seiner Familie sagt das Gegenteil aus, der slowenische Zweig, zu dem Handke sich seit jeher bekennt, war antinazistisch eingestellt, in mehreren fiktionalen Werken – oft nur »leicht« fiktionalisiert, so daß der autobiographische Hintergrund durchscheint – kommt dies zum Tragen, und die Hinwendung des Autors zuerst zu Slowenien und dann, als Jugoslawien zu zerfallen begann, zu Serbien, ist nur eine späte Konsequenz dessen (Sympathien mit dem Nazismus gab es historisch vor allem in Kroatien). Der Nationalsozialismus ist für Handke der Inbegriff von Gewalt, und seine Entschlossenheit, dieser Gewalt mit seinen Mitteln zu begegnen, zieht sich ebenfalls durch sein Werk. Ein frühes Beispiel (aus dem Jahr 1989) ist die kleine Epopöe Versuch des Exorzismus der einen Geschichte durch eine andere, enthalten in dem Sammelband Noch einmal für Thukydides. Was hier ausgetrieben werden soll ist die Okkupations- und Besatzungsgeschichte der Deutschen in Frankreich, und zwar am selben Ort, wo eines der Folterzentren gewesen war, durch eine friedliche Geschichte der kleinen Dinge und menschlichen Verhältnisse abseits der Historie, die immer wieder zu Blutbädern führt. Die Erzählung vom zweiten Schwert, dem friedlich-literarischen nämlich, ist nichts anderes als ein solcher, allerdings ausgedehnterer Versuch des Exorzismus, und Handke beansprucht in diesem Alterswerk, daß so eine Austreibung gelingen kann – was sich rückblickend auf sein gesamtes Schaffen beziehen läßt.
Eine andere Art des Eingreifens schildert Handke in Der Chinese des Schmerzes (1983). »Der Betrachter greift ein«, so lautet dort schon die Überschrift des Mittelteils; dieser an sich friedfertige Betrachter rafft sich zur Gewalttat auf, nachdem er in der Umgebung seines Wohnorts Hakenkreuze bemerkt hat. Zufällig begegnet er dem Täter, gerät sogleich in Rage, tötet ihn mit einem Steinwurf und wirft ihn vom Mönchsberg, den man hier unschwer wiedererkennt, auf die in Salzburg so genannte Selbstmörderterrasse hinunter. Er steht zu seiner eigenen Tat, muß aber erfahren, daß er sich im Tötungsakt dem Nazi-Täter angeglichen hat, sozusagen Gleiches mit Gleichem vergeltend, Gewalt gegen Gewalt. Trotzdem: »Es war Recht geschehen«, so steht es Wort für Wort im Text. Dieses Recht ist kein Recht im rechtsstaatlichen Sinn, es ist Selbstjustiz – oder eben: Rache. Auch in Das zweite Schwert rechtfertigt der Ich-Erzähler die Selbstjustiz, weil er zur Justiz kein Vertrauen mehr hat (zwei Desillusionierungen in der Handkeschen Biographie: Journalismus und Justiz). »Und war das Sühnenlassen denn nicht Sache der Obrigkeit? Nichts da von Obrigkeit und Amtlichkeit! Ein Amt dagegen wohl: Das Rache-Amt, und es war das meine.« Allerdings erfolgt diese Rechtfertigung im ersten der beiden Teile der Erzählung. Im zweiten Teil sieht er davon ab und ersetzt das Rache-Amt durch das literarische Schreiben beziehungsweise Nicht-Schreiben, die rhetorische Ellipse, das Aussparen der Bösewichtin. Genau darin besteht der große Erzählbogen dieses Werks. Es stellt eine Alternative zum Eingreifen in Der Chinese des Schmerzes dar, einen Schritt zwar nicht zur Versöhnung, doch zur Besänftigung, die ein Abwenden von den Gewalttätern und Hinwenden zu den Dingen und ihren Formen nach sich zieht.
Im Absatz, der auf die Annahme des Rache-Amts folgt, erinnert sich der Ich-Erzähler an eine andere Episode, eine einzige in seiner Biographie, in der er sich das Rache-Amt angemaßt hatte. Diese Episode ist in Handkes Kindergeschichte (von 1981) beschrieben, und dieser Verweis zeigt, wie stark sein Schreiben über die einzelnen Werke hinweg autobiographisch geprägt ist: Autofiktion, gewiß, aber in Tuchfühlung mit dem tatsächlich Gelebten. Dort wird sein noch nicht zehnjähriges Kind in Frankreich von einem Mann mit dem Tod bedroht unter dem Vorwand, daß es zum Volk der Täter gehöre und, obwohl eine Nachgeborene, schuld sei am Tod von Millionen Juden. Der Vater steckt ein Messer ein und macht sich auf den Weg zum Absender des Drohbriefs, empfindet die Situation dann aber, einmal vor Ort, als grotesk und sieht von seinem Vorhaben ab. Zuvor hatte er sich noch »großartig dastehen« sehen, »in der weltrichterlichen Haltung eines Vollstreckeres«, der zu seiner Handlung befugt ist.
Auch hier werden der Erzähler und sein Angehöriger auf die Seite der historischen Gewalttäter gestellt – zu unrecht, wie man in beiden Fällen sagen kann –, und der Schriftsteller wehrt sich dagegen. In anderen Fällen ist er derjenige, der sich aufgefordert sieht, gegen die Nazi-Gewalt vorzugehen – die Frage ist nur, mit welchen Mitteln, durch Gegengewalt oder durch friedliche Verwandlung. Klar ist, daß für Handke die Erfahrung des Weltkriegs und die Geschichte des Nationalsozialismus mit ihren konkreten Auswirkungen auf seine Familie der eine, immer noch nicht erloschene Herd der Gewalt ist, gegen die er mehr oder minder mit seinem gesamten Werk anschreibt. Dabei sind die autornahen Figuren, die Alter-Egos, nicht immer nur die Guten, sie begehen selbst Untaten – in der Kindergeschichte schlägt der Vater einmal sein Kind »mit aller Gewalt« – und stehen manchmal lächerlich da, stotternde Idioten, wie Handke sie zuweilen in Anspielung auf sich selbst gezeichnet hat.
Doch Handkes Flanier- und Amokgeschichten sind oftmals an äußeren Ereignissen arm, und so stellt sich noch einmal die Frage, wie man die bloße Fortbewegung, den sanften Gang oder den zornigen Lauf, erzählerisch bewältigt. Es ist eine Abfolge von Erregungen und Beruhigungen, ausgelöst durch konkrete Wahrnehmungen, deren Bewertung im Verlauf der Handlung ebenfalls wechseln kann. So kommt es in einem fort zu Intensivierungen des Erzähltons, zu Steigerungen, die wie Wellen kommen und gehen und dann wieder entspannteren Phasen Platz machen. Der Amoklauf ist naturgemäß ein Höhepunkt der Erregung; zusammen mit der reinen, interesselosen Anschauung im Sinne Goethes und Schopenhauers durchzieht er als immer wieder neu variiertes Thema das Gesamtwerk. Der Aufbruch selbst, also das Verlassen des Hauses und der Beginn des Schreibens an einem Text, ist die Form der Erregung (die nicht unbedingt destruktiv sein muß, positiv gewendet ist sie Begeisterung), während die Pause und das ruhige Nebeneinandersetzen von Wahrgenommenem, oft mit der schlichten Konjunktion »und«, der Entspannung entsprechen. Von Systole und Diastole hatte Goethe gesprochen, von Krisen, die immer wieder gelöst werden müssen, auch in der Mikrostruktur des Geschehens in der Natur, der letzten Endes die menschlichen Geschichten entsprechen; von »Ein- und Ausatmen der Welt, in der wir leben, weben und sind.« Bei Handke sind die Krisen einerseits mit Erlebnissen und Erinnerungen verbunden, in denen Gewalt eine Rolle spielt, andererseits auch mit dem formlosen Durcheinander und der Zudringlichkeit der Umgebung, die das Subjekt, das deshalb nicht zum Betrachter werden kann, nicht in Ruhe läßt – am deutlichsten nachvollziehbar in Episoden der Lärmbelästigung, die in seinen Büchern seit geraumer Zeit regelmäßig vorkommen und in Die Morawische Nacht in einem Symposion über »Stille und Lärm« gipfeln. Der Ich-Erzähler gesteht in Das zweite Schwert, er habe schon als Kind Gewaltphantasien gehabt (da ist er wohl keine Ausnahme) und sei einmal als Heranwachsender drauf und dran gewesen, den gewalttätigen Stiefvater mit der Axt zu erschlagen – was den Handke-Leser an die Atmosphäre von Wunschloses Unglück erinnert. Es ist wahrscheinlich eine der die Erzählung intensivierenden Übertreibungen, wenn er sagt, er habe sich »zum Mörder geboren gefühlt«, doch die wiederholte Empfindung eines Impulses der Zerstörung werden wir ihm durchaus glauben können.
In seiner Rede bei der Verleihung des Ivo Andrić-Preises sagte Handke im Mai 2021, die Literatur habe »vielleicht viel mit Zorn zu tun, auch mit Wut (was manchmal gut ist), aber nie mit Haß! Und das ist der große Unterschied.« Offen gestanden kann ich diese Differenzierung nicht recht nachvollziehen. Entsteht Zorn nicht aus Haß auf etwas oder jemanden? Ist der Amokläufer nicht ein Menschenfeind, oder zumindest einer, den ein sehr allgemeiner Haß umtreibt, sei es gegen »die Ausländer«, »die Ungläubigen«, »die Politiker« oder »die Journalisten«, so daß oft nur ein Funke – ein frisch gemaltes Hakenkreuz oder ein lärmender Nachbar – genügt, um ihn ausrasten zu lassen? Haß auch auf Dinge, jawohl, zum Beispiel auf die Säge, mit der der Erzähler im Versuch über den geglückten Tag einen Stamm durchzuschneiden versucht, was ihm nicht auf Anhieb gelingt. An dieser Stelle erinnert er sich an den »ländlichen Großvater«, der für Zornausbrüche und Verfluchungen berühmt gewesen sei. Handke sieht sich und sein Tun – wenn der biographische Brückenschlag erlaubt ist – seit jeher in der Tradition dieses Großvaters; er scheint auch dessen Unbeherrschtheiten geerbt zu haben, und ein Teil seines Werks spürt diversen Möglichkeiten nach, mit diesen umzugehen. In Descartes‘ Mechanik der Gefühle (Les passions de l’âme) gehört der Haß zu den wenigen – es sind nicht mehr als sechs – grundlegenden Emotionen und wird stets paarweise mit der Liebe besprochen. Das Gefühl der Liebe läßt uns die Nähe der geliebten Person oder des geliebten Gegenstandes suchen; Haß bedeutet, daß wir uns von jemandem oder etwas trennen wollen, daß wir es lossein wollen, notfalls durch Vernichtung (wenn es sich um starken, echten Haß handelt). Der plötzlich erregte Zorn ist bereits eine abgeleitete Emotion, die den dauerhafteren Haß aktiviert, wenn das Subjekt durch ungehöriges Verhalten oder andere Widrigkeiten – ein (vermeintlich) defektes Sägeblatt – gereizt wird. Bei der erwähnten Preisverleihung im ostbosnischen Višegrad, wo die Wunden der Bruderkämpfe gewiß noch nicht verheilt sind, gab sich Handke betont friedliebend, und das war sicher gut so (westliche Berichterstatter wollten es nicht wahrhaben). Doch für seine Literatur sind der aggressive Impuls und seine Sublimierung von Anfang an prägend. Berühmt wurde Handke durch seine Publikumsbeschimpfung, die gewissermaßen die literarische Verlängerung der Flüche des Großvaters darstellte, und eine der Figuren seiner frühen Schaffensphase, der bereits zitierte Josef Bloch, ist ein schizophrener Mörder, für dessen Tat es kein rechtes Motiv gibt, abgesehen davon, daß ihm die Welt als solche zu Leibe rückt, was teilweise auch für die späteren Amokläufer Handkes gilt. Soweit ich sehe, gibt es im Werk Handkes zwei autornahe Mörder, nämlich den Ex-Tormann, der eine Frau tötet, die er eben erst kennengelernt hat, und den Rächer auf dem Mönchsberg, der zwar eine gute Sache für sich beanspruchen kann, doch ebenfalls im Affekt handelt. Der Schauspieler in Der Große Fall sieht sich phasenweise als Retter – besonders gegenüber einem angehörigen, seinem Sohn – und phasenweise als Vernichter, ja, durchaus auch als Rächer. In Das zweite Schwert betrifft diese Vernichtungswut, dieses Weghaben-Wollen in einem der übersteigerten Momente die ganze Menschheit. Es ist zunächst ein innerer Kampf zwischen den beiden Seelen des Erzählers (was in pathologischer Steigerung Schizophrenie bedeutet), ein Kampf der beiden grundlegenden psychischen Impulse, bei dem es darum geht, den Menschenhaß in Menschenscheu zurückzuverwandeln, also zu einem ruhigen, Abstand haltenden, beschaulichen, gewähren lassenden Verhalten zu finden, das ihm »eigentlich« – im Sinn des Sanften Gesetzes – entspricht.
»Verwandeln« ist eines der poetologischen Hauptwörter Handkes; ein anderes ist »umspringen«, sind die Kippbilder. Verwandlung bewirkt die zugrunde liegende, stetige Erzählarbeit des Autors, seine Suche nach den Formen, die das dem Subjekt unerträgliche Chaos bezähmt, sowie deren sprachgerechte Mitteilung. Das Umspringen wiederum geschieht in den Momenten, für die der wahrnehmende Autor offen zu sein hat, die er gewissermaßen erhaschen will, die besänftigenden, oft nur sehr kleinen Wahrnehmungen und Wertungen-Umwertungen dessen, was ihm auf seinen regionalen Reisen begegnet.
»Regional«, wenn wir an die in der mehr oder weniger stark mythisierten Niemandsbucht und ihrer näheren Umgebung stattfindenden Geschichten denken, doch im Grunde genommen gilt dies auch für seine balkanesischen und spanischen Erzählungen: Die Welt ist bei Handke als solche regional –weder global noch national – und nur als solche friedlich. Sie wird vom Standort aus, der oft der Wohnort ist, nach und nach erschlossen. Und die Geschichten und Wahrnehmungsfragmente, die sich on the road, in der Fortbewegung, egal ob per pedes, im Bus, im Vorortezug oder neuerdings auch in der Straßenbahn ergeben und eröffnen, bilden zusammen, in ihrer wellenhaften, gleichsam musikalischen Abfolge die größere, am Ende und im Ganzen dann besänftigende Erzählung. Besänftigend: den Autor, den Leser, die regionale Welt. De facto, auch das wissen wir, führt oft genug diese erzählerische Friedensliebe – »Friedenswahn« heißt es einmal in Immer noch Sturm – also diese Friedensliebe, deren Ambivalenz man nicht akzeptieren und deren Herkunft man nicht sehen will, zu Erregungen in der medialen Welt und damit zu neuen Konflikten. Der Anlaß ist oft irgendein Literaturpreis, der dem guten Mann, der sich zeitlebens redlich bemüht hat, auf seine alten Tage verliehen wird.
»Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.« So lautet einer der Aphorismen Kafkas. Wenn es ein Ziel gibt, wird es unwichtig; ja, es verschwindet. Was bleibt, ist der Weg, aber der Weg besteht aus Aufbrüchen und Verschiebungen, aus Aufschwüngen, die immer wieder abgebrochen werden – und im ganzen wie durch ein Wunder doch eine Linie ergeben, auch wenn sie innerlich ist, innerlich und aufgeschrieben, mitgeteilt, überliefert. Handkes Literatur enthält einen ungeheuren Schatz an Wahrnehmungsbildern, an oft auch ähnlichen oder gleichen Dingen, die immer wieder in leicht verändertem Licht erscheinen. In diesem Sinn ist die Welt niemals entdeckt, sie wird nie zu Ende entdeckt sein, und sie ändert sich ja auch ständig, und der sorgsam Wahrnehmende und Reflektierende ändert sich ebenfalls in seinem Zögern, weiterzugehen, wie auch in seinem Zögern, einzugreifen. Hamlet, der Prinz von Dänemark, soll den ermordeten König, seinen Vater, rächen, aber er tut es nicht, weil die Schuld des Schuldigen, des Täters, erst erwiesen werden muß – und wer sind wir, um zu urteilen, zu richten? Bei Handke ist es die Mutter, die stillschweigend die Rache fordert und selbst einmal als Rächerin erscheint: »Genug gerächt!« antwortet zuletzt der in die Jahre gekommene Sohn. Der beredte Ausdruck des Zögerns des Nachfahren ist das Drama, und es ist – im 21. Jahrhundert – das erzählend besänftigende Schreiben, das sich im Erzählen selbst noch einmal befragt und in Frage stellt und aus dieser Reflexion literarische Funken schlägt. Das zweite Schwert ist, oder genauer: es wird metaphorisch und fungiert damit auf einer Metaebene.
Schwerter zu Pflugscharen! Seltsam, daß weder Handke selbst, der auch in Das zweite Schwert biblische Texte schreibend mitbedenkt und unter der Hand neuschreibt, diese alte Prophezeiung, die später zum Motto und zur Maxime umgewandelt wurde, kein einziges Mal erwähnt und daß sie auch, soweit ich sehe, in Besprechungen des Buchs nicht vorkommt. Doch genau dies versucht Handke unermüdlich: aus den Kriegswerkzeugen solche des Friedens zu schmieden, sprachliche Werkzeuge der Anschauung und der Arbeit, des Bestellens der Felder. Sein großes Projekt seit seiner »klassischen« Wende Ende der siebziger Jahre war und ist es, die antiken Epen von Krieg und Eroberung durch Epen und Epopöen vom friedlichen Werken und vom Müßiggang zu ersetzen. Das zweite Schwert vollzieht genau diesen sich mit den Wellen der Variation wiederholenden Vorgang und macht ihn zugleich zum Thema. Den Bleistift nicht aus der Hand legen, lautet das stille Motto. Weiterschreiben: immer noch Sturm, immer noch Literatur, immer noch die Bezähmung des Sturms.
© Leopold Federmair
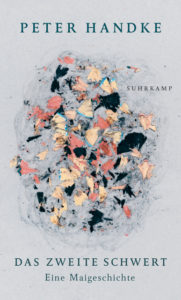
Danke Leo…Gedanken aus dem Gesamtwerk. Gedanken eines guten Lesers