Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Die Entstehung eines Schriftstellers. Er oder sie entdeckt für sich die Literatur, mit Hilfe von Eltern oder Großeltern oder der Bibliothek des Vaters oder der Schulbibliothek, meist frühzeitig, liest Bücher, sondert sich ab, versucht selbst zu schreiben, man braucht dazu nur einen Bleistift, Papier, eine Schreibmaschine. Talentiert oder stümperhaft, in jedem Fall ehrgeizig, wird sie oder er langsam besser (außer Rimbaud, der war von Anfang an – aber nur für drei Jahre – der, der er war), eine Zeitschrift oder Zeitung oder heute er selbst, im Internet, veröffentlicht seinen ersten Text.
Ganz anders Thomas Bernhard. In seiner Jugend schwer erkrankt, mit dem Überlebenskampf ausgelastet, dann Musik, Gesang, Journalismus. Eigenes Schreiben relativ spät, und zwar Gedichte. Die wurden veröffentlicht, im Otto Müller Verlag. Wir schreiben 1957, 1958, im damaligen Kontext klingen seine Gedichte etwas altertümlich, sie riechen nach Georg Trakl (dessen Werk ebenfalls im Otto Müller Verlag erschien). In hora mortis, ein barocker Titel, lateinisch wie damals noch die katholische Liturgie, wie sie in Österreich in zahllosen Barockkirchlein durchgeführt wurde. Und dann plötzlich Frost, 1963, etwas ganz anderes, ein Roman, der alle stilistischen, thematischen und motivischen Eigenschaften aufweist, die bis zuletzt das Werk Bernhards kennzeichneten. Das Interessante, für mich jedenfalls: Bernhard hat das lyrische Frühwerk hinter sich gelassen. Es ist, als hätte Frost eine andere Person geschrieben als der Verfasser von In hora mortis. Zwischen beiden Phasen gibt es keinen Zusammenhang.
Wie so oft regt sich auch hier ein: And yet… Und doch. Denn erstens bleibt der Tod, die Vergänglichkeit, Hinfälligkeit, Nichtigkeit des menschlichen Lebens und Treibens Bernhards thematische Quelle – ich könnte auch sagen: Erfahrungsquelle –, die überreich sprudelte. Auch seine spätere Komik, auf dem Theater wie beim Erzählen, bezieht daraus ihre Kraft. Und zweitens hat Bernhard auf radikalste Weise dichterische Techniken auf seine Prosa übertragen: Antithetik, obsessive Wiederholung, verbunden mit Steigerung (die Rhetorik nennt das »amplificatio«). Im wesentlichen also genau jene sprachstilistischen Verfahren, die Roman Jakobson dem zuordnete, was er als »poetische Funktion« des Sprechens definierte.
Für mich sind bis heute jene Romane und Erzählungen am anziehendsten – oder literarisch am stärksten, falls es denn noch erlaubt ist, ästhetische Wertungen übers Geschmäcklerische hinaus zu äußern –, die aus dem solcherart definierten Poetischen schöpfen, sich diesem immer wieder nähern und eine erzählend poetische Sprache kreieren. (»Kreieren« wie create, auf deutsch »schöpfen«; die alten Griechen, die uns immer noch nachhängen, sprachen von »Poiesis«.) Natürlich gibt es auch die Kunst des Erzählens als solche, es gibt hervorragende, schöpferische mündliche Erzähler, die nie auf die Idee kämen, etwas vom Erzählten niederzuschreiben. Aber auch in diesen spontanen Erzählungen, die sich um Sprachliches gar nicht bewußt kümmern, wirkt und werkt die poetische Funktion. Es ist nicht nur Sprache, nicht nur Rhetorik, die dabei zur Anwendung kommen, es ist auch ein Hantieren und Komponieren mit erzählerischen Einheiten, Blöcken, kleineren narrativen Elementen. Das alles wurde längst bemerkt und erforscht, im akademischen Raum mit oft wahnwitziger, abgehobener Begrifflichkeit (Gérard Genette!), die mit dem tatsächlichen Erzählen nicht mehr viel zu tun hat und den Erzählern selbst, sollten sie je davon Kenntnis erhalten, nichts nützt.
Es kommt also darauf an, das Erzählen und die poetische Funktion zusammenzuführen. Thomas Bernhard hat das auf ebenso radikale wie eigenwillige Weise gemacht. Ja, Bernhard war, diversen Zeitzeugen zufolge, sehr eigensinnig. Ein Sturschädel, wie man sie im bairisch-westösterreichischen Raum bis heute nicht selten antrifft.
»Ich brauche etwas, das ich Wort für Wort lesen könnte«, schrieb Handke in sein Journal Das Gewicht der Welt, als er 1976 in einem Pariser Krankenhaus lag, und fast ein halbes Jahrhundert später antworte ich leise mit einem Ratschlag: »Proust!« (Übrigens ein Satz, der meine, der ziemlich an Handkesche Satzbauformen erinnert.) Aber Handke hat Proust nie sonderlich geschätzt. Dabei war die Recherche, Anfang des 20. Jahrhunderts, auch eine Art Epos, eigentlich kein Roman, vielmehr ein In-die-Weite-Welt-hinaus-Schreiben – die weite Welt der Erinnerung –, eine Epik, wie sie Handke später anstrebte und praktizierte, von der Niemandsbucht über den Bildverlust bis zur Obstdiebin; noch nicht 1976, vor der Wende, die Langsame Heimkehr bedeutete.
Der Roman Langsame Heimkehr – nein, die Genrebezeichnung ist »Erzählung«, obwohl 200 Seiten lang – gehört ebenfalls zu den Büchern, die ein Wort-für-Wort-Lesen fordert, wenigstens passagenweise, vor allem zu Beginn. Fordert, weil das auch eine Forderung des Textes ist, und eine Anforderung für den Leser; der muß zu dieser Art von Lektüre bereit und imstande sein. Er muß mitarbeiten, kooperieren, sonst steigt er aus, kommt nicht in den Genuß dessen, was das Buch zu bieten hat. Mühe und Lust bilden bei solcher Literatur ein Paar. Das schöne Paar Mühe und Lust.
Literaturübersetzer sind geradezu verpflichtet, auf solche Weise zu lesen, andernfalls können sie ihren Beruf nicht ausüben. Sie übersetzen aber nicht Wort für Wort, sondern Satz für Satz, manchmal auch Bild für Bild und, letzten Endes, Kapitel für Kapitel und Text für Text. Aber zuerst einmal müssen sie entziffern, in die Wörter eindringen, müssen warten, lauschen, die Wörter von vorne und von hinten, von oben und von unten anschauen, die Bilder erkennen, die die Wörter in Verbindung mit den Wörtern ihrer Umgebung enthalten. Sie müssen die Wörter abklopfen – na ja, ich übertreibe, aber es ist sicher sehr oft ein wiederholtes, wiederholendes Lesen, das sowohl den Rhythmus, den Groove, den Schwung eines Textes erfährt und berücksichtigt als auch, andererseits, die geballte Punktualität der Wörter und Bilder. Punctum und studium. Übersetzen ist zunächst nur eine intensivierte Form des Lesens. Wer sehr genau liest, wird automatisch zum Übersetzer.
Wiederholendes Lesen, das wäre eine gute Formel. Übersetzen = wiederholendes Lesen.
Ich sollte den ganzen Absatz aus dem Gewicht der Welt zitieren: »Ich brauche etwas, das ich Wort für Wort lesen könnte – und nicht diese Sätze, die man auf den ersten Blick erkennt und überspringt, wie in Zeitungen fast immer und leider auch fast immer in Büchern! Sehnsucht nach den Wahlverwandtschaften«. Ja, die Wahlverwandtschaften gehören zu dieser Art von Büchern. Man kann sich Goethes Roman nicht reinziehen (was beim Werther durchaus möglich ist). Handke nennt hier auch das Kontrastprogramm, den Journalismus, der für ihn später zum roten Tuch wurde. Während Literaturkritiker heute oft nach angeblich aktuellen Themen für Romane rufen, über die es angeblich zu schreiben gelte.
Seit langem, wenn nicht immer schon, gilt der Roman als jener literarische Ort, wo Konflikte zwischen Individuum und Gesellschaft abgehandelt werden. Als lösbarer oder unlösbarer Widerspruch, als conditio humana, als existentielle Erfahrung, als politische Aufgabe – wie auch immer, aber stets gibt es eine Kluft zwischen den beiden Seiten, bis hin zum point of no return, zum radikalen Rückzug, zur einsamen Insel, zur apokalyptischen Katastrophe oder zum unerklärlichen Verschwinden sämtlicher Mitmenschen. Auch in diesen Werken hallt die Dialektik von Individuum und Gesellschaft nach. Im kurzen Schlußkapitel von Mein Tag im anderen Land resümiert Handke diese Dialektik, es enthält eine klare Anspielung auf die Idee vom zoon politikon und beschwört auch noch einmal den Außenseiter oder Widerständler (wie in seinem Theaterstück Immer noch Sturm, dort in Gestalt des Partisanen).
Im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Massen (das einundzwanzigste ist nach Byung-Chul Han das der Schwärme), rücken vermehrt das vereinsamte Ich und der dezidiert antigesellschaftliche Held (oder Anti-Held) ins Blickfeld der der Romanschreiber. Die Szene wird nicht mehr beherrscht von den Wilhelm Meisters, die sich um Anerkennung bemühen und ihrerseits die Welt anerkennen, sondern von Typen wie Lenz in Büchners gleichnamiger Erzählung, die aus der Literaturgeschichte der Goethezeit herausfällt. Buddenbrooks von Thomas Mann, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben und Anfang des zwanzigsten erschienen, zeichnet in gewisser Weise diese Entwicklung nach und nimmt sie vorweg. Für die Individuen, hier die Sprößlinge der Kaufmannsfamilie – männlichen Geschlechts, aber auch der Fall der zweimal unglücklich verheirateten Tony ist in diesem Zusammenhang von Interesse –, wird es immer schwieriger, sich in ihre Umwelt zu integrieren, bis die ganze Linie zuletzt abbricht.
Handke bewundert Tolstoi, er könne nicht aufhören, Krieg und Frieden zu lesen, schreibt er in seinem bisher letzten Aufzeichnungsbuch. Krieg und Frieden, ein Roman, den man Wort für Wort lesen kann (nicht muß). »Bei niemand sonst als beim Erzähler Tolstoj geschieht es mir im Lesen, daß das Rad von Schmerz und Freude so mächtig-sanft durch meine Brust rollt, fuhrwerkt, ›konvulsiert‹«. Ja, darauf kommt es an, auf dieses Rollen! Nicht, oder nicht sosehr, auf Genre- und Zukunftsfragen. Auf das Fühlen im Jetzt kommt es an.
»In Light in August ist eine Dauererschütterung, Satz für Satz. Es widerstrebt mir aber, dauernd erschüttert zu werden. – Sondern? – Einmal im Buch, ein einziges Mal, die Erschütterung, nach und nach, dann aber: die Dauer (Faulkner: Stifter)«, notiert Handke während der Neulektüre des Faulkner-Romans. »Erschütterung« dürfte ein anderes Wort für jene konvulsivischen Gefühle sein; Handke gebraucht es immer wieder mal. Ich frage mich, ob meine eigenen Schwierigkeiten mit Faulkner auch damit zu tun haben. Erzählerisch ergibt sein Outrieren eine drängende Dichte, die das Wort-für-Wort-Lesen eigentlich fordert und fördert, aber vielleicht ist das zu drängend, zu verlangend, zu ungestüm, die Freiheit des Gegenübers, also des Lesers, mißachtend? Ich erinnere mich, daß sich Handke für ein luftiges Erzählen aussprach; ein Erzählen, das immer wieder auch locker läßt, seine Gegenstände sein läßt. So etwa, glaube ich, sieht er die Erzählweise Stifters. Das Gewitter ist im Anzug, aber es bereitet sich langsam, sehr langsam vor. Auf der symbolischen wie auf der realen, realistischen Ebene. Und manchmal geht es ja in der Ferne vorüber, an den Figuren wie auch am Leser. Die seltenen Höhepunkte des Erzählens – anstatt einer Maschinengewehrsalve.
Langsame Heimkehr hatte eine Art faulknersche Dichte, und Die Hornissen, Handkes erster Roman, auch. Vielleicht geht es im Leben, nicht nur beim Schreiben, darum, Gelassenheit zu erwerben.
Faulknersche Dichte: Ist das ein Kompliment? Letzten Endes: Ja.
Proust interessiert mich nicht mehr so wie früher. Damals, früher, vorzeiten, las ich die Recherche auf einem Salzburger Bergbauernhof unweit von dem Sanatorium, wo Thomas Bernhard als Jugendlicher interniert gewesen war (in Der Atem erzählt er davon). Ich hatte mich dorthin zurückgezogen, um meine Dissertation über einen spätbarocken Dichter fertigzustellen, und las nach dem Aufstehen, um mich nicht gleich in die Arbeit stürzen zu müssen, gewissermaßen zur Ablenkung, oder zum Aufwärmen, die ersten Bände von Prousts Roman, jeden Morgen eine Stunde oder so. Andere Ablenkungen standen nicht zur Verfügung, keinerlei Medien, nicht einmal Zeitung, außerdem regnete es unablässig, so daß ich nicht einmal Wanderungen unternehmen konnte. Ich las Proust mit Leidenschaft und Gewinn – ich glaube, ich habe seine Art, weitschwingenden Langsätze zu bilden und möglichst viele Details in den Winkeln und Täschchen seiner, Syntax unterzubringen, auf mein Barockthema übertragen.
Jetzt versuche ich ihn wiederzulesen, Original und Neuübersetzung vor mir, aber dieser Marcel – oder diese Marcels – nerven mit ihrem gezierten Getue, ihren lächerlichen Finessen, Obsessiönchen, Wehwehchen (dabei weiß der Erzähler über die Lächerlichkeit Bescheid). Die sprachlichen Endlosgirlanden Prousts gefielen mir früher als ein schönes, freies Spiel mit wenigen Regeln, dem man sich zeitverloren hingeben konnte. Auch Montaigne, schien mir und scheint mir immer noch, zieht gern solche Sprachgirlanden, in einer anderen Zeit und mit anderen Motivationen, aber bei Proust entsteht das Gefühl, daß es sich nicht lohnt.
Was heißt, es lohnt sich nicht? Spiele müssen sich doch nicht lohnen!
Nein, nicht im wörtlichen, materiellen Sinn. Der Lohn wäre die Lust: Lust der Mühe, Lust am Schönen, an der Sprache selbst, an den Formen.
Vielleicht habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit wie damals auf dem Bergbauernhof. Die Zeit war endlos. Für mich. Aber Proust, dieser Fanatiker – als er die Recherche schrieb, hatte so wenig Zeit wie ich jetzt.
Handke: »Zwei Arten von Epik, Erzählen: die eine: wie das Leben dem und jenem so mitspielt, und die andere? – Wie das Leben spielt, so und so, so oder so«. Das betrifft unmittelbar auch den Umgang des Autors mit Figuren. »Immer wieder: unterscheide zwischen ›Akteur der Geschichte sein‹ und ›Im Geschehen sein‹«. So gesehen gibt es in den letzten Büchern Handkes – oder schon sehr lange in seinem Werk – gar keine »Figuren«, also keine Akteure, sondern was? Instanzen mitten im Geschehen, die sich von der Erzählung mitziehen oder tragen lassen. Erst mitziehen, manchmal wie widerwillig, dann tragen. Personen (Personen?), die vor allem wahrnehmen, kaum handeln. Die Erzählung als das Übergeordnete, Höhere, an der X teilhat. Egal, wie man die Instanz nennt, »Figur«, »Person« oder X. Oder Ich. Jedenfalls kein Individuum. Der Widerspruch zwischen Gesellschaft und Individuum also doch aufgehoben? Pure Utopie?
Handke nannte einmal im Gespräch als Beispiele für ein Erzählen, das unserer Zeit entspreche, seine großen Epen, Bildverlust und Morawische Nacht, sowie ein drittes, ich glaube, die Niemandsbucht.
Ich fügte hinzu: »Und die Romane von Modiano.«
Er stimmte mir zu.
© Leopold Federmair

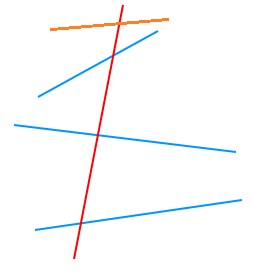
Du erinnerst mich an die Anfänge meines Lesens. Als Dorfkind auf die Gemeindebibliothek angewiesen wurde ich nicht nur sprachlich, sondern auch empathisch geschult. Ich glaube, es hat mich zu einem Menschen gemacht. Später im Studium besonders zu Proust, aber auch zu Bernhard und Dostojewski u.a.hingezogen, verging kein Tag ohne etwas zu zeichnen – weswegen ich ins Gym kam – und zu lesen. Ich war beglückt, dass mir die ges Weltliteratur offen stand. Und das dann meinen Schülern und Schülerinnen weiterzugeben, hat zu einem für mich erfüllten Leben beigetragen. Und auch deine Bücher lese ich mit größtem Vergnügen. Ich will mich im Einzelnen hier nicht weiterverbreiten, nur: Es ist wichtig, dass für unsere Nachkommenschaft die Bedeutung des Lesens und die Literatur erfahrbar wird.