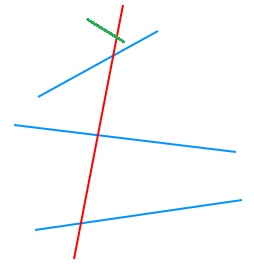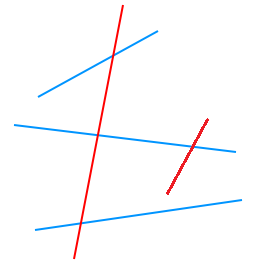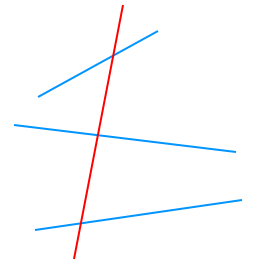Transversale Reisen durch die Welt der Romane
»I play both sides against the middle«, ein Satz, der mir von Bob Dylan her im Ohr klingt. Im Englischen allerdings nur – »nur« – eine gebräuchliche Redewendung, die offenbar eine Haltung wie Opportunismus bezeichnet. Bei mir weckt der Satz ganz andere Assoziationen, er liefert eine gute Beschreibung dessen, was ich seit vielen Jahren als Spannung wertschätze. Das Wort »Spannung« hat verschiedene Bedeutungsnuancen und wird recht unterschiedlich gebraucht. In letzter Instanz verweist das Wort für mich auf den Lebensbogen, den ein jeder zu beschreiben hat und zu beschreiben sucht, und dieser wiederum verbindet sich mit dem, was Heidegger »Entwurf« nennt: Entwurf und Geschick, persönliche Entscheidungen und äußere Bedingungen ergeben im Zusammen- und Widerspiel den Lebensbogen. Romane und größere Erzählungen haben diesen Bogen im Blick oder als Horizont, auch dann, wenn überhaupt nicht von Anfang und Ende die Rede ist. Im gewöhnlichen Leben verlieren wir den Horizont oft aus den Augen; es besteht auch gar nicht die Notwendigkeit, ihn dauernd zu bedenken, aber hin und wieder tut es doch gut.
Beide Seiten gegen die Mitte spielen. Die Extreme in Beziehung setzen, in Beziehung halten. Das ist doch das Gegenteil vom goldenen Mittelweg, auf dem einer sich durchs Leben schwindelt. So einen Satz zu äußern, bedeutet, die Spannung zu suchen und Intensitäten zu leben. Hat Dylan es so gemeint? Keine Ahnung. Die Songs des alten, nunmehr über Achtzigjährigen zehren immer häufiger von Rückblicken (übrigens auch die Bücher von Peter Handke). Das ist nur natürlich, wir sind, vor allem, wenn wir nicht nur älter, sondern alt werden, was wir erinnern, und wie wir es erinnern (und ob). In Key West (Philosopher Pirate) nennt Dylan drei Dichter der Beatnik-Generation, die ihn beeinflußt oder zumindest, als er jung war, beeindruckt haben: Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac (okay, Kerouac war ein Erzähler).