Transversale Reisen durch die Welt der Romane
»I play both sides against the middle«, ein Satz, der mir von Bob Dylan her im Ohr klingt. Im Englischen allerdings nur – »nur« – eine gebräuchliche Redewendung, die offenbar eine Haltung wie Opportunismus bezeichnet. Bei mir weckt der Satz ganz andere Assoziationen, er liefert eine gute Beschreibung dessen, was ich seit vielen Jahren als Spannung wertschätze. Das Wort »Spannung« hat verschiedene Bedeutungsnuancen und wird recht unterschiedlich gebraucht. In letzter Instanz verweist das Wort für mich auf den Lebensbogen, den ein jeder zu beschreiben hat und zu beschreiben sucht, und dieser wiederum verbindet sich mit dem, was Heidegger »Entwurf« nennt: Entwurf und Geschick, persönliche Entscheidungen und äußere Bedingungen ergeben im Zusammen- und Widerspiel den Lebensbogen. Romane und größere Erzählungen haben diesen Bogen im Blick oder als Horizont, auch dann, wenn überhaupt nicht von Anfang und Ende die Rede ist. Im gewöhnlichen Leben verlieren wir den Horizont oft aus den Augen; es besteht auch gar nicht die Notwendigkeit, ihn dauernd zu bedenken, aber hin und wieder tut es doch gut.
Beide Seiten gegen die Mitte spielen. Die Extreme in Beziehung setzen, in Beziehung halten. Das ist doch das Gegenteil vom goldenen Mittelweg, auf dem einer sich durchs Leben schwindelt. So einen Satz zu äußern, bedeutet, die Spannung zu suchen und Intensitäten zu leben. Hat Dylan es so gemeint? Keine Ahnung. Die Songs des alten, nunmehr über Achtzigjährigen zehren immer häufiger von Rückblicken (übrigens auch die Bücher von Peter Handke). Das ist nur natürlich, wir sind, vor allem, wenn wir nicht nur älter, sondern alt werden, was wir erinnern, und wie wir es erinnern (und ob). In Key West (Philosopher Pirate) nennt Dylan drei Dichter der Beatnik-Generation, die ihn beeinflußt oder zumindest, als er jung war, beeindruckt haben: Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac (okay, Kerouac war ein Erzähler).
Solches Namedropping genügt, um Bilder und Zusammenhänge aufleuchten zu lassen. Natürlich muß der Zuhörer oder Leser den Kontext kennen, oder schlichter gesagt: Er muß irgend etwas über die Personen und Orte wissen; am besten, er hat etwas mit ihnen erlebt, auch wenn es nur das häufige Anhören einer LP ist oder die Erinnerung an Dallas, wo John F. Kennedy ermordet wurde. In Murder Most Foul, einer sechzehnminütigen Ballade, die um den Präsidentenmord von 1963 kreist, tut Dylan kaum etwas anderes als Namen Revue passieren zu lassen. Ich kannte nicht alle – heutzutage kann man sich leicht kundig machen –, aber doch ziemlich viele. Ich sage »Ballade«, weil hier tatsächlich eine Geschichte erzählt wird: die Geschichte einer Person, die mitten im Strudel war (wie es im Prinzip jeder ist oder sein kann), und die Geschichte einer Generation. Rückblick, davon zehren wir; nicht oder nicht mehr von der Zukunft. Es kommt darauf an, wie die Namen gereiht werden. Je nach dem, kann die Evokationskraft so eines Songs stärker oder schwächer sein. Im Grunde genommen hat das Dylan immer schon so gemacht, nur daß der Inhalt – die Bildlichkeit – früher visionär und surreal war, in diesem Sinn: eher nach vorne gerichtet. Dylans Balladen waren und sind Listen, Litaneien (wie beim jungen Handke Publikumsbeschimpfung, Selbstbezichtigung oder auch Ready-Mades wie die Aufstellung des 1. FC Nürnberg oder die japanische Hitparade, beides irgendwann 1968): What did you see, my blue-eyed son? – I saw a newborn baby, a highway of diamonds, a white ladder…
Gegen die Mitte: Als Mitte zählt nur, was durch die Spannung zwischen den Extremen errungen ist. Man muß sich den Extremen erstmal aussetzen, sonst zählt das Sammeln von Erfahrungen gar nichts. Solches Ausgesetztsein kann einen auch zerreißen. Risiken und Nebenwirkungen des Lebens.
Eigentlich wollte ich von etwas anderem, von jemand anderem sprechen, der Satz von Dylan sollte nur als Steigbügel dienen.
Kennen Sie Sara Gallardo? – Diese Frage stellte mir vor einigen Jahren ein Lektor im Wagenbach Verlag, und ich mußte verneinen, ich kannte nur ihren Namen, hatte nichts von ihr gelesen.
Sara Gallardo wurde 1931 in Buenos Aires geboren, sie stammte aus einer Familie von Politikern, Schriftstellern, Journalisten, Gelehrten (ähnlich wie Péter Nádas!) und verdiente sich ihr Brot zeitlebens als Journalistin. Ihr Ururgroßvater Bartolomé Mitre war der erste Präsident der Republik Argentinien. Was heute als Nationalliteratur dieses Landes betrachtet wird, geht auf das frühe 19. Jahrhundert zurück, das Versepos El Gaucho Martín Fierro gilt als Nationalepos. Damals, in den Anfängen, bildete sich ein spezielles Genre heraus, das meist als »literatura de frontera« bezeichnet wird, eigentlich Literatur von jenseits der Grenze, womit die weitläufigen, von indigenen Stämmen bewohnten Gebiete nach Westen und Süden zu – von Buenos Aires aus betrachtet – gemeint sind. Der Roman Eisejuaz von Sara Gallardo gehört vielleicht zu diesem Genre; in den Buch ist, in seltsamem Spanisch, die Stimme eines mataco zu vernehmen, eines Ureinwohners der Region Chaco im Norden Argentiniens, fern von Buenos Aires. Dieser mataco, zur christlichen Religion bekehrt, glaubt die Stimme des Herrn zu hören und versucht, sich gegen die Ungerechtigkeiten der weißen Herren zu wehren. In der halb anarchischen, Chronologien herausfordernden Erzählweise erinnert der Roman an jene von William Faulkner, besonders an Schall und Wahn.
Was ich an dieser Stelle sagen will – Eisejuaz ist ein mustergültiges Beispiel für eine Erzählliteratur, die den Standpunkt und die Perspektiven des ganz Anderen einnimmt und darzustellen versucht. In diesem Sinn läßt sich der Begriff »literatura de frontera« in einem viel weiteren, nicht ethnographisch eingegrenzten Sinn verstehen. Es handelt sich um das Gegenteil des Ich-Romans (shishousetsu in Japan): Schreiben als vollständige Loslösung vom Selbst. Eine solche Loslösung ist vielleicht am besten durch bloßes Zuhören und Aufnehmen zu erreichen; wiewohl die Ergebnisse zeigen, daß Gestaltung notwendig ist und delirierende mündliche Diskurse – und welche wären nicht delirierend? – in der Regel zerfallen wie schlecht geknetete Knödel, wenn man sie ins Kochwasser legt. Zu gestalten wußte Sara Gallardo sehr wohl, aber sie hat, als Journalistin, zunächst eine Reise in den Chaco unternommen und Lisandro Vega stundenlang reden lassen und dabei mitgeschrieben, um dann, zurück in Buenos Aires, einen Artikel über Lisando Vega in der Wochenzeitschrift Confirmado zu veröffentlichen. Später wurde aus dem Gehörten und Aufgezeichneten ein Roman. Gallardo hatte dafür nicht einmal den Namen der Hauptfigur, Lisandro Vega, geändert. Eisejuaz ist sein Rufname; ich weiß nicht, ob er irgendeiner real existierenden Sprache angehört, im Buch wird er als »ese también« ausgelegt, was ungefähr »der andere auch« heißt. Ich glaube, solche Bücher schreiben sich, wenn man als Autor mit Hilfe von Gott Zufall den Faden in die Hand und den Ton ins Ohr bekommt, von selbst. Jemand anderer schreibt sie. Der Andere. Ese también.
Etwas ähnliches kann man als Autor manchmal mit Kindersprache und Kinderperspektive erleben, wobei das Kind unter Umständen jenes ist, das der Autor vor vielen Jahren war. Es geht darum, über die Grenze ins Unbekannte vorzudringen. Letztlich sprechen wir hier vom Erzählprinzip als solchem: sich in den anderen hineinversetzen, Identitätsgrenzen überschreiten, den Figuren folgen wie ein unsichtbarer Geist. Respekt – ich sage lieber: Achtung – vor dem anderen, Einfühlung und Nachahmung, Aufnahme von Fremdelementen ins Eigene: all das schließt sich keineswegs aus. Erzählen heißt bereits, kulturelle Aneignung zu treiben. Wer solche Aneignung ablehnt, lehnt das Erzählen ab.
Ich lasse wieder mal ein paar Namen fallen, stelle unerwartete Nachbarschaften her. Ähnlichkeitsnachbarn. Ähnlichkeiten und Unterschiede strukturieren das Denken. Nichts gegen das Ziehen von Vergleichen. Die laufen dann sowieso nicht auf das Gleiche – das Dritte, tertium comparationis – hinaus. Unterwegs, erst unterwegs, entdeckt man Besonderheiten. Und doch auch das Gleiche, zum Beispiel zwischen Eisejuaz und Narayama bushiko (von Shichirou Fukazawa), zwei Bücher, die auf den ersten Blick gar nichts gemeinsam haben, in Wahrheit aber doch, denn der erste Blick denkt einfach nur: Japan und Argentinien, was hat das miteinander zu tun.
Für mich und meinen x‑ten Blick sehr viel, wenngleich nur durch Zufall (der einer der wichtigsten Helfer des Transversalismus ist). Im Narayama-Buch geht es darum, wie in einem Gebirgsdorf die Alten zum Sterben auf einen Berg geschafft werden. Die Alten sind mit diesem Brauch einverstanden, sie scheinen in Frieden zu sterben. Europäer mögen das für eine archaische Sitte, die Lieder der Dorfbewohner für altjapanisches Kulturgut halten. Falsch. Fukazawa hat – im Unterschied zu Gallardo – alles erfunden. Gemeinsamkeiten: Das Rohe und zugleich Feinsinnige dieser Anderen; das Sentimentale, die Liedhaftigkeit gleichsam des Denkens; das Musikalische, der Rhythmus der Sprache. Ich denke auch an Abgesang des Königs, von Yuri Herrera näher zu unser unfein-rohen Gegenwart geschrieben (die Narcos in Mexiko!) – noch eines dieser Bücher, von denen ein Autor in seinem Leben nur eines schreiben kann, niemals eine Serie, weil es eigentlich der Andere geschrieben hat, und dieser Andere teilt sich selten mit. Ich kenne ihn nicht, niemand kennt ihn wirklich, aber ich glaube, er ist sehr streng in seiner Auswahl. Nicht wie die Muse, die ziemlich beliebig irgendwen küßt. Verrückte Bücher. Neulich ist mir Mimoun von Rafael Chirbes in den Sinn gekommen, der Roman spielt in Marokko. Als ich dem Autor gegenüber, gut zwanzig Jahre ist es her, diesen seinen Erstling besonders lobte, war er peinlich berührt: »Ja, damals war ich ziemlich verrückt.« Danach ist er vernünftig geworden, hat Artikel für eine Gourmet-Zeitschrift (Broterwerb) und wohlgeordnete Gesellschaftsromane geschrieben, aber leider nie zu rauchen aufgehört, was zu seinem frühen Tod beigetragen hat. Was man halt so nennt, früh. Er starb genau in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Es wird langsam Zeit.
Paqui, das undankbare euroamerikanische Arschloch in Eisejuaz, vom Mataco, der selbst am Hungertuch nagt, versorgt und am Leben erhalten, ist ein Städter, ein Intellektueller wie Ulrich, der Held des typisch großstädtischen Romans Der Mann ohne Eigenschaften (Bücher wie die zuletzt genannten stehen zu dieser Art von Literatur in unaufhebbarem Gegensatz): eitel, selbstbezogen, griesgrämig, untreu, undankbar, rücksichtslos usw. Diese Figuren haben sehr wohl Eigenschaften, und zwar eine ganze Menge. Einen Mann oder eine Frau ohne Eigenschaften wird es in der Erzählliteratur niemals geben, das wäre eine contraditio in adjecto. Vielleicht jemanden, der seine Eigenschaften, nachdem sie ihm angeeignet worden sind, loszuwerden versucht, bei diesem Unterfangen können wir ihn oder sie dann lesend erleben. Jedenfalls, das wollte ich sagen, dieser Paqui ist ein unangenehmer Typ wie jener Ulrich, das Alter Ego des unangenehmen Robert Musil (siehe die 1500-Seiten-Biographie von Karl Corino).
Irgendwie, aber ich weiß beim besten Willen nicht wie, erinnert mich Eisejuaz auch an die Dichtung Hölderlins. Hilft mir jemand auf die Sprünge? Jemand, ein Schwunggeber, ein Trampolin.
Also Roman – novela corta, vielleicht auf deutsch: kleiner Roman – Eisejuaz ist wohldosiert, wohlproportioniert, für den Leser fordernd, anstrengend, aber auch angenehm, herzerwärmend. Das, was Literatur sein kann: Arbeit und Spiel, beides in einem, Spiel aus Arbeit hervorgehend. Nicht zu groß, nicht zu klein, sondern. Eine Alternative zum Groß(stadt)roman, zu den Angebern à la Musil. Das alles vielleicht ohne Absicht der Autorin, die sich der Andere gesucht hat. Als hätte das Buch sich geschrieben. Oder seine Hauptfigur hat es geschrieben, die Autorin hat ihm ihr Ohr geliehen. Siehe oben.
© Leopold Federmair
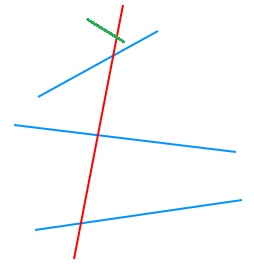
This article is about a Serbian tradition. For other uses of »lapot«, see Lapot (disambiguation).
Lapot (Serbian: лапот, pronounced [lâpot][1]) is the legendary practice of senicide in Serbia:[2][3][4] killing one’s parents, or other elderly family members, once they become a financial burden on the family. According to T. R. Georgevitch (Đorđević), writing in 1918 about the eastern highlands of Serbia, in the region of Zaječar, the killing was carried out with an axe or stick, and the entire village was invited to attend. In some places corn mush was put on the head of the victim to make it seem as if the corn, not the family, was the killer.[5]
Georgevitch suggests that this legend may have originated in tales surrounding the Roman occupation of local forts.
The Romans ... were very bellicose people. Their leader ordered all the holders of the fort up to forty years of age to be active fighters, from forty to fifty to be guards of the fort, and after fifty to be killed, because they have no military value. Since that period the old men were killed.[5]
Anthropologist Senka Kovač, in a study on aging, mentions that the name »lapot« is given to this custom of killing the elderly in eastern Serbia.[4]
In a study published in 1999, Bojan Jovanović argues that earlier anthropologists such as Trojanović, Georgevitch, and Čajkanović had confused myth with reality and that the well-known story of a grandson who had hidden his grandfather to protect him from lapot after a bad harvest, bringing him back to the village when the old man’s wisdom had shown a way to survive, was the basis for establishing that the old should be respected for their knowledge and wise counsel.[6]
The tradition was the topic of the 1972 TV docudrama Legenda o Lapotu (The Legend of Lapot) by Goran Paskaljević, in which after a bad harvest, an elderly man who could no longer work was ritually slain.[2][7][8][9] The 1992 novel Lapot by Živojin Pavlović received the NIN Prize.[10][11] In 2004, Italian news agency ANSA reported from Belgrade that an attempt by the Serbian government to introduce a law restricting free dispensing of lifesaving medicines to the over 60s, had been described by the Serb media as a case of »lapot«.[12]
Vielen Dank! Ihre Essays sind so anregend, dass ich gleich ausrücken möchte, selbst orthogonal zu Ihrer transversalen Lektüre eine horizontal, spiralförmige Reihe zu starten.
Zum Kommentar von Dragan Aleksić: Es ist die Wiedergabe eines englischen Wikipedia-Artikels über »Lapot«, einer einst in Serbien teilweise praktizierten Form von Senizid, übersetzbar etwa als »Altentötung«. In einem deutschen Wikipedia-Artikel zu dieser Thematik sind noch in anderen Ländern praktizierte Formen aufgeführt.
Es geht um die Stelle im Essay, als von Shichirou Fukazawas Buch Narayama bushiko die Rede ist, in dem in einem Gebirgsdorf die Alten zum Sterben auf einen Berg zum Sterben geschafft werden.
@ Dragan Aleksic
Aus dem hier geposteten Wikipedia-Artikel geht nicht klar hervor, ob »lapot« auf reale historische Praktiken zurückgeht oder ob das »nur« Legenden sind. Ich nehme an, letzteres. Ich glaube nicht, daß Fukazawa vom serbischen »lapot« wußte; sein Roman wurde 1956 erstveröffentlicht. Die Idee, zur Last fallende Alte zu »entsorgen«, ist in jedem Fall nicht gar so weit hergeholt. In einer stark überalterten Gesellschaft wie der gegenwärtigen japanischen wird sie wieder virulent. Die Regisseurin Chie Hayakawa hat sie unlängst in ihrem sehr feinfühligen Film »Plan 75« aufgegriffen. (Siehe dazu auch meinen Artikel in der Neuen Zürcher: https://www.nzz.ch/feuilleton/japan-ueberaltert-und-kommt-auf-die-idee-beim-ableben-zu-helfen-ld.1698058)
In Deutschland gab es 2007 einen dystopisch-utopischen Fernsehfilm in drei Teilen, der für Furore sorgte. Schon der Titel 2030 – Aufstand der Alten gab Anlass zur Empörung. Der Kern des Films bestand darin, wie man mit der Boomergeneration, die unzweifelhaft um 2030 herum in Rente gehen würde, umgeht. Schließlich wurden die Alten in Billigheime in Afrika untergebracht, wo sie ruhiggestellt wurden und langsam vor sich hin starben, ohne die Bevölkerung in Deutschland über Gebühr zu belasten. Dahingehend richtete sich der »Aufstand«.
2030 war damals noch unendlich weit weg; heute sind es sechs Jahre. Es gibt Notstand in vielen Altenheimen, weil kaum mehr Pflegepersonal zur Verfügung steht. Gleichzeitig ist noch gar nicht der Höhepunkt erreicht. Die Politik drückt sich seit Jahrzehnten vor diesen Fragen und beschwichtigt, nicht zuletzt, weil diese Altersgruppe relevant ist für Wahlen. In einigen sozialen Netzwerken habe ich schon »Vorschläge« gelesen, die in die Richtung des Fernsehfilms von 2007 gehen. Das kam hauptsächlich von jüngeren Aktivisten.
Im Film »Plan 75«, dessen Handlung wohlgemerkt Fiktion ist, verfolgt die Regierung ein sanftes Programm zur Entsorgung der Alten, wobei Freiwilligkeit Voraussetzung ist. Übrigens hat man auch in Fukazawas Roman den Eindruck, daß die Alten mit ihrem Abtransport auf den Berg (nicht nach Afrika) einverstanden sind.
Ich selbst gehöre nicht zu den Jungen, vielmehr muß ich mich bereits mit meiner eigenen Entsorgung auseinandersetzen. Ein freiwilliges, möglichst sanftes Ende kann ich mir schon vorstellen. Nicht in naher Zukunft, keine Angst. Aber wenn ich über 75 bin.
Mit solchen Überlegungen bewege ich mich in die Gegenrichtung zu jenen Techno-Milliardären, die die Unsterblichkeit anstreben.
Schon Walt Disney strebte nach Unsterblichkeit, beschäftigte sich mit Kryonik, d. h. dem Einfrieren nach dem Tod oder auch womöglich schon zuvor, um dann einige Jahrzehnte später aufzuwachen. Er starb an Krebs; ein Einfrieren hätte nichts geholfen.