Niemand spricht das hehre Wort von »der Kultur« so inbrünstig aus wie Tina Mendelsohn, wenn sie wieder einmal in einem »Kulturzeit extra« oder irgendeiner Radiodiskussion mit Funktionären und Kulturschaffenden zusammensitzt und über die Zukunft »der Kultur« diskutiert. Leider kommt man dann ziemlich schnell auf den eigentlichen Punkt: das Geld. Hier subventionierte Geldeintreiber, die längst verinnerlicht haben, dass Kultur und Geld siamesische Zwillinge sind und in Institutionen und Etats denken. Und dort die Kommunal‑, Landes- und Bundespolitiker, die mit dem Wort »Kultur« zunächst einmal jene Form von Event-Fetischismus verbinden, den sie jahraus jahrein eröffnen, befeiern, besuchen und beschließen. Wie steht es mit einer »Kultur«, wie sie sich in der Auftaktveranstaltung zur Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010 in Essen vom 10. Januar 2010 zeigt?
Gregor Keuschnig
Leerstelle Gysi?
Marianne Birthler, die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, hatte im ZDF am 22. Mai 2008 (laut Spiegel Online) in Bezug auf ein Treffen zwischen Gregor Gysi und seinem Mandanten Robert Havemann gesagt: In diesem Fall ist willentlich und wissentlich an die Stasi berichtet worden, und zwar von Gregor Gysi über Robert Havemann.
Gregor Gysi hatte gegen die Weiterverbreitung dieser Äußerung geklagt und vor dem LG Hamburg recht bekommen. Das ZDF ging in Berufung und unterlag jetzt erneut. Interessant ist die Begründung. Es geht scheinbar gar nicht darum, ob Birthlers Aussage richtig ist oder falsch. Laut OLG darf die Äußerung Birthlers nur nicht in der Art und Weise, wie dies erfolgte, wiedergegeben werden. Das ZDF schreibt zur Urteilsbegründung auf seiner Webseite: »Nach Auffassung des Gerichts hätte das ZDF jedoch Gysi konkreter zu den Äußerungen Birthlers befragen und Gysis Verteidigungsargumente ausführlicher darstellen müssen.«
Robert Habeck: Patriotismus – Ein linkes Plädoyer
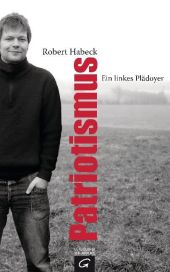
Die Feindschaft zum Staat als Repressionsinstanz, »Atomstaat«, »Bullenstaat«, als paternalistischer Akteur, Hüter fauler Kompromisse, verstellte den grünen Blick darauf, was (mit einem) geschehen würde, wenn man selbst zu dem gehörte. Der zivile Mut wollte immer über den Staat hinaus, zielte auf die Idee eines Gemeinwesens ohne Staat. Als dann rot-grün 1998 an die Regierung kam, waren die liberalen Vorstellungen von Gemeinwohl nicht mehr gegen, sondern mit dem Staat durchzusetzen. Auf diesen Schritt waren die progressiven Kräfte schlecht vorbereitet und sind es bis heute.
Hart geht Robert Habeck, 41, Fraktionsvorsitzender der Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag, mit der Linken im Allgemeinen und seiner Partei im Besonderen ins Gericht (womit die politische Richtung und nicht dezidiert die Partei »Die Linke« gemeint ist). Nach rot-grün, so Habecks These, habe das Land in einer Großen Koalition, die ihre Chancen leider (!) sträflich verpasst habe, vier Jahre verloren.
Alban Nikolai Herbst: Selzers Singen
»Phantastische Geschichten« werden Alban Nikolai Herbsts Erzählungen, die unter dem Titel »Selzers Singen« soeben erschienen sind, untertitelt (und ergänzt wird das ein bisschen kokett mit: »und solche von fremder Moral«). Das Adjektiv phantastisch ist eine zutreffende Charakterisierung dieser zwölf Geschichten (die kürzeste hat knapp vier Seiten, die längste 24), wobei der Grad der »Phantastik« durchaus ...
Christoph Simon: Spaziergänger Zbinden
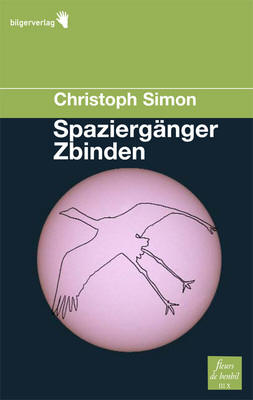
Lukas Zbinden ist 87 Jahre alt und geht mit dem neuen Zivildienstleistenden Kâzim einen Tag durch das Betagtenheim. Er stellt ihm die ehrbaren Damen und exzentrischen Herren, die gesprächigen Witwen und die schweigsamen Junggesellen, die routinierten Gehrockbenützer, schlurfenden Stubenhocker mit dörrfleischigen Gesichtern vor, weist dezent auf die Verwirrten, deren Gedanken durcheinanderrollen wie Erbsen auf einem Teller hin und begegnet medizinisch Betreuten mit einem Cocktail in den Adern, bei dem Blut eine nebensächliche Zutat ist. Dieser Ort beherbergt ausgediente Ingenieure, Gewerbetreibende, Büroangestellte, Hausfrauen, Beamte, Armeeangehörige, Feuerlöschgerätekontrolleure, Busfahrer, Übersollarbeiter, Service, Papeterie und Leute, die sich Urlaub erst gönnten, als Ferien gesetzlich vorgeschrieben wurden.
Schon dieser Beginn zeigt die Stimmung dieses Romans an, der ein einziger Monolog des ehemaligen Lehrers Lukas Zbinden ist. Die Entgegnungen der anderen Personen bleiben dem Leser verborgen; er entnimmt sie allenfalls Zbindens Reaktionen. Dieser klettert die Treppenstufen hinab und hinauf als sei er auf einer Expedition (wie eloquent die Benutzung des Fahrstuhls trotz der Mühsal des Treppensteigens abgelehnt wird, obwohl: während der Liftfahrt baut man draußen in wenigen Sekunden die Welt um), nimmt am Alltag der ihm begegnenden Bewohner und Pfleger regen Anteil, lästert vereinzelt ein wenig, amüsiert und ärgert sich über die übertriebene Geschäftigkeit des Heimleiters und stellt Kâzim dabei wie einen persönlichen Pfleger vor.
(Pl)Attitüden des Kabaretts
Desillusionierende und messerscharfe Analyse des deutschen politischen Kabaretts in der Süddeutschen Zeitung von Burkhard Müller – »Dumm zu sein bedarf es wenig.« Zunächst macht Müller einen Parforceritt durch die Kulturgeschichte des Kabaretts, um dann festzustellen:
Das Kabarett war im alten Westdeutschland, neben Magazinen wie Stern und Spiegel, eine der wichtigsten Ausdrucksformen der Sozialdemokratie auf der Zielgeraden. Gibt es etwas Beflügelnderes, als kämpfender Held und doch schon sicherer Sieger zu sein? Was das Kabarett seinem dankbaren Publikum schenkte, war die beseligende Teilhabe an diesem Gefühl. Der persönliche Angriff auf den Mächtigen und die persönliche Gefahr, die er bedeutet, die Explosion des Witzes, die einen Geltungsanspruch zerfetzt wie eine Handgranate den Leib des Potentaten: das setzt im Fall des Gelingens gewaltige Mengen Glückshormone frei.
Der Hinterweltler und die Ignoranz
Tatsächlich war es vielleicht noch zu keiner Zeit weniger schwierig als heute zu Wirkung und Geltung zu gelangen; und gerade weil es so leicht ist zu »wirken«, scheint es unmöglich zu wirken.
Von jeder Plakatsäule droht ein neuer, besonderer Weltumsturz, schreien Enthüllungen, locken frisch entdeckte Dimensionen. Die Folge ist, daß sich niemand mehr darüber aufregt; außer den Leuten natürlich, die von ihrer Aufregung leben.
Wir sind überfüttert mit Gedanken.*
Ist das die Klage eines gut bezahlten Redakteurs eines (sogenannten) Qualitätsmediums, der seine Meinungsführerschaft durch neue, obskure Kräfte unterminiert sieht? Oder einfach nur eine Feststellung eines desillusionierten Bloggers, der das souveräne Ignorieren durch die etablierten Medien sträflich unterschätzt hatte und trotz aller Anstrengungen seine regelmäßigen Besucher problemlos in einem Mittelklassewagen unterbringen könnte? Und mittendrin der seufzende Leser, Zuschauer, Zuhörer: Wir hingegen stöhnen unter der Last von [...] Meinungen, von denen jede einzelne nicht Unrecht hat und die doch weder einzeln, noch mitsammen das Gefühl der Wahrheit geben. Es scheint, wir sind mitten im aktuellen Überforderungs-Klagediskurs à la »Payback«.
Leo Perutz: Zwischen neun und neun
Tatsächlich eine gelungene Neuauflage von Leo Perutz’ 1918 erschienenem Buch »Zwischen neun und neun«. Neben der temporeichen Erzählung gibt es einen kleinen aber feinen, fünfseitigen Anmerkungsteil und ein kenntnisreiches,
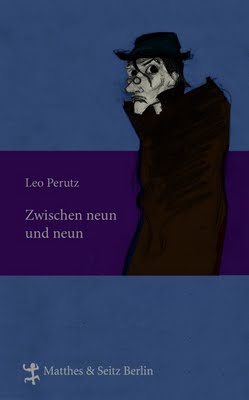
»Zwischen neun und neun« – das sind zwölf Stunden im Leben des Stanislaus Demba im Mai 1917. Demba lebt als Student in Wien und ist ein kauziger, zuweilen cholerischer Geselle, der sich als Nachhilfe- bzw. Hauslehrer in den besseren Kreisen verdingt. Er hat herausbekommen, dass seine Freundin Sonja einen neuen Liebhaber hat, mit dem sie am nächsten Tag nach Venedig fahren will. Demba will dies unbedingt verhindern, akzeptiert Sonjas Abwendung nicht und glaubt, sie umstimmen und mit ihr die Reise machen zu können, wenn er ihr das Geld in den nächsten Stunden vorlegt. So hastet er nun durch die Großstadt, möchte ein (gestohlenes) Buch verkaufen, treibt Schulden ein, erbittet Vorschüsse und findet sich sogar am Bukidomino-Spieltisch wieder, obwohl er die Regeln gar nicht kennt.
