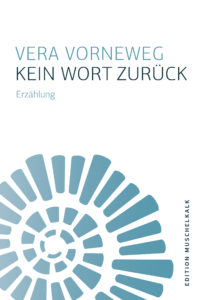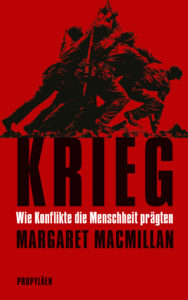abenteuerliches Herz I
»Mein abenteuerliches Herz I« – schon im Titel findet man diese Mischung aus Anspruch und Anmaßung. Es wird beim Aufschlagen noch deutlicher: Der Autor Heimo Schwilk mit Ernst Jünger 1988 im Gespräch. So muss ein Jünger-Biograph seine Tagebuchaufzeichnungen nennen und beginnen, denkt man. Die römische Ziffer lässt zudem einen zweiten Band erwarten. Der erste umfasst Eintragungen vom 3. Februar 1983 bis zum 1. Januar 2000. Diese werden ohne jede Gliederung chronologisch aufgeführt – mit Ortszeile und Datum. So fliegen die Jahre dahin, wenn man nicht immer genau auf das Datum schaut. Es zeigt sich, dass die Einträge meist etwas später entstanden sind und Ereignisse einiger Tage zuvor zusammenfassen.
Zu Beginn ist Schwilk 31 Jahre alt und versucht, in Kontakt mit Ernst Jünger zu kommen. Anderthalb Jahre später – im Buch sind es noch nicht einmal 30 Seiten – ist es soweit. Er sitzt in Wilflingen mit Ernst und Liselotte Jünger zusammen. Eine Biographie kann es nicht mehr werden (daran arbeitete bereits der NZZ-Mann Martin Meyer). Mit Klett-Cotta hatte man sich aber auf eine Bildbiographie verständigt. Mehrere Sitzungen und Sichtungen in Wilflingen. Parallel plante Schwilk eine Dissertation über die Jünger-Tagebücher und überlegt, inwiefern diese Stilisierungen enthalten.
Die Frage stellt sich natürlich auch für die vorliegenden 634 Seiten. Damit keine Zweifel aufkommen, verortet sich Schwilk schon im (glücklicherweise knappen) Vorwort bei den »reflexiven Diaristen« wie Jünger und Gide. Nichts werde beschönigt, so das Versprechen. Tapferkeit gegen den Mainstream wird angekündigt. Mit dem Untertitel »Aus den Tagebüchern…« legt man allerdings den Schluss nahe, dass es durchaus Streichungen gibt. Und nach der Lektüre hätte man sich sicherlich viele (weitere?) Auslassungen gewünscht. Etwa all die privaten Probleme und Problemchen, die Ehekonflikte, seine Episoden über die Kinder – kurz: all das, was privat und intim bleiben sollte, denn ein Journalist ist nicht wie ein Schriftsteller eine öffentliche Figur (wobei man auch hier streiten kann, ob beispielsweise die Idiosynkrasien eines Thomas Mann immer relevant für sein Werk sind). Weniger wäre mehr gewesen, vor allem im Hinblick auf die Gegenwart. Diskretion ist keine Kernkompetenz von Heimo Schwilk.