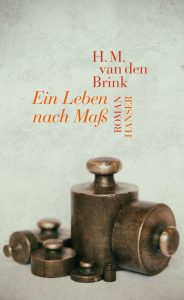
Ein Leben nach Maß
Seit einigen Wochen erscheint er regelmäßig im Traum und plötzlich steht er dann schweigend in der Wohnung: Karl Dijk. Jener ehemalige Arbeitskollege des namenlosen Ich-Erzählers in Hans Maarten van den Brinks »Ein Leben nach Maß«. Es ist irgendwann um 2009, der Erzähler ist Mitte 60. Er ist pensioniert, ein ehemaliger Mitarbeiter der Eichbehörde. Natürlich ist das eine Halluzination, ein Fiebertraum, der immer wieder Fragmente des Lebens hervorspült. Und besonders eben jene Zusammenarbeit mit Karl Dijk, der Eigenbrötler, der hartnäckig Abwesende, der selbst seiner Abschiedsfeier fernblieb, was die umtriebige Direktorin nicht davon abhielt, die vom Erzähler verfasste Rede vorzutragen.
Es beginnt am 2. Januar 1961 als der Erzähler 18jährig seinen Dienst beim Eichamt beginnt und dort den wenig älteren Karl Dijk trifft. Es ist der Tag des ersten und letzten Händedrucks; so eng die Zusammenarbeit auch teilweise war, es wird nie derart intim. Noch existent sind Tradition und Ethos einer Behörde, die die Waagen der Lebensmittelhändler, Marktleute, Fleischer, Drogisten und Apotheker kontrolliert – sei es, dass man ihnen diese bringt oder sie im Außendienst besucht. Sie sind wenig beliebt, zuweilen werden sie sogar bedroht. Der Prüfer als Feind und man beginnt an Josef Roths »Das falsche Gewicht« zu denken. Und es ist die Zeit, in der die »permanente Veränderung…noch nicht erfunden« war.
Aber nachträglich sieht man sie natürlich. Aus den Dörfern wurden Vororte, aus Wiesen Gewerbegebiete und aus der Behörde ein privates Dienstleistungsunternehmen. Die Straßen sind voller Autos, aber längst ohne die Fahrzeuge der mobilen Bäcker, Fleischer und Lebensmittelhändler. Das alles wird leicht, lakonisch, aber niemals verklärend erzählt. Kein »Früher war alles besser«, denn schließlich stanken die Grachten erbärmlich nach Müll, Unrat und »Entengrütze«. Und die Kunden wurden beschummelt.


