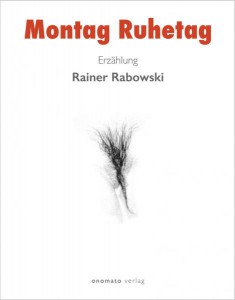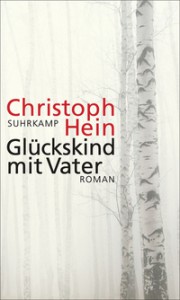
Glückskind mit Vater
In einem Gespräch aus dem Jahr 1993 mit Carsten Gansel, das im neulich vom Verbrecher-Verlag herausgegebenen Gesprächsband »Literatur im Dialog« abgedruckt wurde, hatte Christoph Hein sich selber als »Chronisten« bezeichnet, der nur das beschreiben könne, was er mit seinen Augen gesehen habe. Seinen Chronistenstatus hat Hein auch danach nie aufgegeben, obwohl er zwischenzeitlich mit zahlreichen anderen Etiketten wie »politischer Autor« versehen oder gar unsinnigerweise als Ostalgiker bezeichnet wurde. Seine Helden seien allesamt »Trotzköpfe« hieß es einmal (als sei dies schon ein literaturkritisches Kriterium); ein andermal verortete man sie im intellektuellen Milieu. Letzteres stimmt nicht, denn »Willenbrock« war ein braver Autohändler, in »In seiner frühen Kindheit ein Garten« portraitiert Hein in einer Mischung aus Verklärung und Kitsch den RAF-Terroristen Wolfgang Grams und in »Landnahme« wird das Leben eines Unternehmers erzählt, der sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hatte.
Abgesehen von einem sich erst im weiteren Verlauf erschließenden kurzen Prolog begegnet man in Christoph Heins neuem Buch »Glückskind mit Vater« der Hauptfigur Konstantin Boggosch zunächst als 69jährigen Rentner in der (ost-)deutschen Provinz mit seiner zweiten Frau Marianne, die infolge einer Hüftoperation gehandicapt ist. Boggosch ist dort als ehemaliger Lehrer und Schuldirektor bekannt und geschätzt. Ein rundes Gründungsjubiläum des Gymnasiums steht an und eine junge Journalistin der Lokalzeitung möchte ein Interview mit ihm. Es sollen alle noch lebenden ehemaligen Schuldirektoren zu Wort kommen und auf einem Bild posieren. Aber Boggosch ist mürrisch und weist die Journalistin nach kurzer Bedenkzeit ab. Seine Welt sei untergegangen, sagt er in einer Mischung aus Resignation und Verbitterung. Gleichzeitig geht ein Brief vom Finanzamt an einen gewissen Konstantin Müller ein.