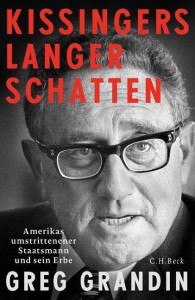Judiths Hund, warum fällt er mir jetzt wieder ein? Als wäre er die heimliche Hauptfiguer jener Jahre. Ich sehe ihn vor mir, besser gesagt: neben mir, wie er still in einer Ecke des Hörsaals liegt und manchmal die Ohren bewegt, als lauschte er den mehr oder minder klugen Diskussionen im Seminar. Damals regte sich kein Mensch darüber auf, daß Hunde oder Kleinkinder an die Universität mitgenommen wurden. In manchen Seminaren war es erlaubt zu rauchen, und es war überhaupt kein Problem, die Räumlichkeiten am Wochenende für Feste zu nutzen (die Portiere feierten mit). Ich will nicht sagen, daß es damals besser war, die Luft in den Zimmern war wirklich verpestet, aber . . . Nun ja, der Hund hörte zu und dachte mit, wenigstens sah es so aus, während wir uns in endlose Gedankengefechte verstrickten. Judith hatte ihm einen typischen Hundenamen gegeben, Bello oder Waldi oder Ajax, etwas in dieser Art, einen Namen, der überhaupt nicht zu seinem melancholischen Gemüt paßte. Sie selbst hatte einen ähnlichen Blick, vor allem, wenn sie András anschaute, der sie so wenig beachtete. Dabei war sie eine schöne Frau, die schönste weit und breit, daran zweifelte niemand. Aber das schien András nicht zu jucken; er vergnügte sich lieber mit Hausfrauen, die unter seiner Anleitung das sich abzeichnende Übergewicht ihres Körpers bekämpften.
Judith hatte keine Probleme dieser Art. Kein Wunder, sie war zehn, fünfzehn Jahre jünger als diese Frauen. Wenn ich an Musils Roman denke, fällt mir auf, daß Ulrich überhaupt keine ernstzunehmenden Geschlechtspartnerinnen hat, jedenfalls keine, die er von sich aus ernstnimmt, ernstnehmen will. All diese Diotimas und Gerdas und Bonadeas – höhere Hausfrauen der Jahrhundertwende. Und dann, als der Strang der Frauengeschichten durchzuhängen beginnt, plötzlich die eigene Schwester, die angeblich vergessene. Warum ausgerechnet die eigene Schwester? Gibt es in der kakanischen Großstadt unter den zwei Millionen Einwohnern wirklich keine einzige schöne Frau, die vom Alter und vom geistigen Niveau her zu ihm passen würde? Vielleicht hat András Judith verschmäht, weil sie nicht in das Anders-Schema paßte. Oder weil dieser Ulrich-Typus, den er willentlich oder, was wahrscheinlicher ist, unwillentlich verkörperte, für solche Frauen keinen Sinn hat, weil er nichts mit ihnen anfangen kann. Weil sie ihn öffnen, lockern würden? So sah es Judith selbst, in manchmal nachtlangen Gesprächen vertraute sie es mir an. »Seine Panzerungen werden abfallen, wenn er sich erst einmal auf mich einläßt.« Das war der Stil, den wir damals pflegten. András hat sich aber nicht auf sie eingelassen. Ob er nicht wollte oder nicht konnte, wer will diese Frage entscheiden? Am wenigsten er selbst . . . Er ließ sich nicht auf Judith ein, nicht einmal durch die Heirat, die er auf dem Standesamt wie einen mittelmäßigen Scherz absolvierte (ich war Trauzeuge). Judith weinte, und der, der seit ein paar Sekunden ihr Mann war, machte irgendeine ironische Bemerkung. Kein einziger Verwandter war zugegen, auch nicht der Musiker-Vater, nur eine kleine Schar Paralellaktionisten in ihrem üblichen Aufzug. András hatte die Heirat akzeptiert, damit Judith ein Visum für die USA bekäme, wo er ein Jahr lang studieren oder forschen sollte, postgraduate, ein für mich damals neues Wort. Und Judith, die New York für das Mekka der Psychoanalyse hielt, brannte auf die Reise. Sie führte nicht nach New York, sondern in die Provinz, nach Maryland.