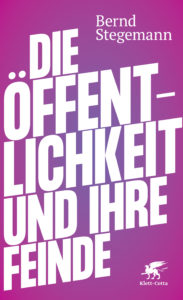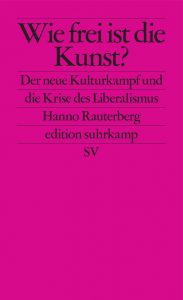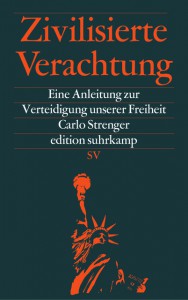Die Selbstgerechten
Sahra Wagenknecht gehört in Deutschland zwar zu den bekanntesten Politikern der Partei Die Linke (hier im weiteren »Linkspartei« genannt, um diese von der allgemeinpolitischen Richtung »Linke« abzugrenzen), aber ist auch ein Beispiel dafür, dass Bekanntheit, überparteiliche Beliebtheit und Respekt nicht automatisch mit Einfluss in der jeweiligen Partei verbunden ist. Man spricht dann schnell von jemanden, der »in der falschen Partei« sei.
Man kann Wagenknecht vieles vorwerfen, aber Angst vor Konflikten gehört nicht dazu. Trotz ihrer Entmachtung nebst Ablösung als Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag 2019 und dem mehr oder weniger sichtbaren Scheitern einer außerparlamentarischen, linken Sammlungsbewegung »aufstehen« wagt sie sich immer wieder ins Getümmel. So wurde sie unlängst zur Spitzenkandidatin der Linkspartei in NRW gewählt, was dahingehend interessant ist, weil Wagenknecht eigentlich nichts mit diesem Bundesland zu tun hat. Was sie nicht davon abhält, im Wahlkreis Düsseldorf II anzutreten.
Zum innerparteilichen Streitfall wurde die Kandidatur unter anderem durch die Publikation ihres neuesten Buches »Die Selbstgerechten«, in dem Wagenknecht furios mit dem sogenannten »Linksliberalismus« ins Gericht geht, für den sie bisweilen den leicht despektierlichen, aber griffigen Begriff »Lifestyle-Linke« verwendet.
Allen Bekenntnissen zum Trotz ist »Die Selbstgerechten« bisweilen durchaus auch eine Abrechnung. Dabei ist es kein Zufall, dass es starke Übereinstimmungen mit Bernd Stegemanns »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde« gibt – war doch Stegemann Mitgründer und im Vorstand von »aufstehen«. Wagenknechts Vorhaben geht aber weiter. Zwar kritisiert sie zunächst auf rund 200 Seiten die sogenannte »linke« Identitätspolitik, aber anschließend folgen auf rund 140 Seiten Positionierungen für eine neue, zeitgemässe »linke« Politik, die diesen Namen verdienen soll.
Entfremdete Lifestyle-Linke
Im Fokus von Wagenknechts Kritik steht der »Linksliberalismus«. Damit meint sie ausdrücklich nicht die sozialliberale Politikrichtung der Regierungen zwischen 1969 und 1982: »Wenn in diesem Buch von Linksliberalismus die Rede ist, ist der Begriff immer im modernen Verständnis als Bezeichnung für die Weltsicht der Lifestyle-Linken gemeint und nie in dem früheren Wortsinn.« Diese Unterscheidung sei wichtig weil beide Denkrichtungen nichts miteinander zu tun hätten. Den Begriff verwende sie trotzdem, weil er sich etabliert habe. Damit verfährt sie ähnlich wie in ihrem Buch »Freiheit statt Kapitalismus« von 2011, in dem »Neoliberalismus« ebenfalls in der zeitgenössischen Konnotation (vulgo: dereguliertes Wirtschaftssystem) verwendet wird und nicht im Sinne der ordo-liberalen Entwürfe von Eucken und Müller-Armack (obwohl sie diese erwähnt).
Die vorgebrachte Diagnose ist beileibe nicht neu: Sich links wähnende Aktivisten, mehrheitlich akademisch ausgebildet, solide Mittel- bis Oberschicht, großstädtisch, »weltoffen und selbstverständlich für Europa, auch wenn jeder unter diesen Schlagworten etwas anderes verstehen mag«, besorgt ums Klima, setzt sich für »Emanzipation, Zuwanderung und sexuelle Minderheiten ein«. Sie usurpieren den Diskurs innerhalb der politischen Linken. Der Nationalstaat ist diesen »Lifestyle-Linken« ein Auslaufmodell: Man schätzt »Autonomie und Selbstverwirklichung mehr als Tradition und Gemeinschaft. Überkommene Werte wie Leistung, Fleiß und Anstrengung findet [man] uncool.«
Wagenknecht konstatiert eine Entfremdung der Linken mit ihren potentiellen Wählern: »Früher gehörte es zum linken Selbstverständnis, sich in erster Linie für die weniger Begünstigten einzusetzen, für Menschen ohne hohe Bildungsabschlüsse und ohne ressourcenstarkes familiäres Hinterland. Heute steht das Label links meist für eine Politik, die sich für die Belange der akademischen Mittelschicht engagiert und die von dieser Schicht gestaltet und getragen wird.«
Gemeint ist der bisweilen verbitterte, in Universitäten aber auch sozialen Netzwerken bis hinein in die Publizistik geführte Kampf für Sprach- und Sprechge- bzw. verbote, vor allem jedoch gegen vermeintlichen Rassismus und Diskriminierungen von Minderheiten. Er will allerdings, so Wagenknecht, keine rechtliche Gleichheit, sondern ufert aus in »Quoten und Diversity, also für die ungleiche Behandlung unterschiedlicher Gruppen.« Die Folge: »Der identitätspolitische Linksliberalismus, der die Menschen dazu anhält, ihre Identität anhand von Abstammung, Hautfarbe, Geschlecht oder sexuellen Neigungen zu definieren, […] spaltet […] da, wo Zusammenhalt dringend notwendig wäre. Er tut das, indem er angebliche Minderheiteninteressen fortlaufend in Gegensatz zu denen der Mehrheit bringt und Angehörige von Minderheiten dazu anhält, sich von der Mehrheit zu separieren und unter sich zu bleiben. Nachvollziehbarerweise führt das bei der Mehrheit irgendwann zu dem Gefühl, die eigenen Interessen ihrerseits gegen die der Minderheiten behaupten zu müssen.« (Hervorhebungen S. W.)