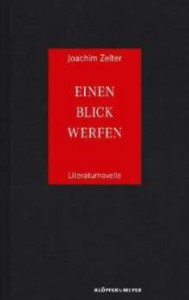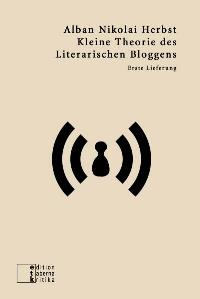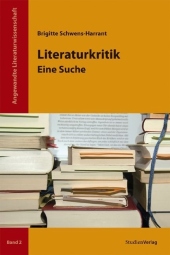Daß ich überhaupt Literaturkritik geschrieben und veröffentlicht habe, liegt daran, daß ich als junger Mann auf den Besitz von Büchern versessen war, aber nicht genug Geld hatte, mir welche zu kaufen. Als Rezensent hat man ein Recht auf sein Rezensionsexemplar, man läßt sich nicht mit losen Druckfahnen abspeisen. Später dann, als ich nach Argentinien und von dort nach Japan ging, trennte ich mich von meiner mittlerweile stattlichen Bibliothek. Schon vorher waren mir die Bücher mehr und mehr zur Last geworden: die Wohnung verstaubte, und es wurde immer schwieriger, eine Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich sagte mir, das Wesentliche dieser Gebrauchsgegenstände, ihren Inhalt sozusagen, hätte ich ohnehin in meinem Kopf gespeichert, und so verkaufte ich die gesamte Bibliothek zu einem Spottpreis (abgesehen von einigen Ausnahmen wie der Pléiade-Werkausgabe von Borges). Ich fühlte mich erleichtert und habe diesen Schritt nie bereut.
Mit meiner kritischen Tätigkeit fuhr ich fort, aus Trägheit und anhaltender Neugier. Hatte ich die Bücher gelesen, verschenkte ich sie oder ließ sie irgendwo zurück. Das digitale Zeitalter hatte inzwischen begonnen, und ich war froh, daß mir die Verlage pdf-Dateien schickten anstelle von Bücherpaketen. Sie taten es anfangs mit einem gewissen Mißtrauen, ganz so, als könne man mit digitalem Gut mehr Schindluder treiben als mit analogem. Daß ich auf die Zusendung eines »echten« Buchs verzichtete, verstanden sie nicht; hartnäckig schickten sie mir das Rezensionsexemplar, das mir zustand.
Eigentlich wollte ich immer schon Schriftsteller werden, aber es mangelte mir am nötigen Selbstbewußtsein. So war ich überrascht und glücklich, als mir gegen Ende meines Studiums, als ich nolens volens irgendwelche beruflichen Schritte unternehmen mußte, wozu ich gänzlich unfähig war, der Leiter einer Literatursendung im Radio auf meine Anfrage zurückschrieb, er wolle mich unter seine freien Mitarbeiter aufnehmen. Kurz darauf ergab sich für mich, nachdem zwei andere Bewerber abgesagt hatten, die Möglichkeit, als Lektor an eine Universität nach Frankreich zu gehen, und ich ließ sie nicht verstreichen. Erst einige Jahre später, als ich immerhin schon einen Roman in der Schublade hatte und ein wenig aus dem Französischen übersetzte, begann ich wirklich, Literaturkritik zu schreiben, aus dem eingangs erwähnten Grund, denn mein Brotberuf war nie besonders einträglich. Damals ging man noch persönlich in Redaktionen, um Text zu liefern, anfangs tatsächlich noch auf Papier, dann auf einer Diskette, die ich in einen Schlitz am Hauptcomputer der Zeitung, für die ich schrieb, stecken mußte.
Der zuständige Redakteur fragte mich damals, was ich sonst so täte. Ich wußte keine rechte Antwort, von meinen Schubladen wollte ich nicht erzählen, und so lautete der Kommentar des Redakteurs zu meinem Gestotter: »Aber vom Artikelschreiben kann man doch nicht leben.« Danke für die Auskunft, dachte ich und war zu perplex, um zu antworten. Auf die Idee, mir irgendwelche Hinweise, eine kleine Handreichung zu geben, kam der Mann nicht. Umgekehrt kam ich nicht auf die Idee, die mir auf abstrakter Ebene durchaus bekannt war, daß man nämlich seine Ellbogen einsetzen muß, um sich im Medienbetrieb ein sei es auch noch so kleines Plätzchen zu verschaffen (im Literaturbetrieb gilt dasselbe, auch unter Übersetzern). Bei der Wochenendbeilage derselben Tageszeitung bekam ich nach annähernd zehn Jahren freier Mitarbeit Schwierigkeiten, weil ich in anderen Organen zu veröffentlichen begonnen hatte. Man erwartete von uns Schreiberlingen, daß wir dem Blatt treu blieben – so sah die Freiheit aus. Ausnahmen wurden bei sogenannten Berühmtheiten gemacht, die durften veröffentlichen, wo sie wollten.
Diese Geschichten spielen in Österreich, einem engen Ländchen mit sogenannter Pressekonzentration, wo Eifersüchteleien und Mißtrauen gang und gäbe waren. Andererseits: Vom Artikelschreiben kann man nicht leben – vor allem nicht, wenn man nur für ein Organ schreibt. Ich versuchte zu wechseln, was mir auch nicht recht gelingen wollte, und war froh, als sich die Möglichkeit ergab, regelmäßig für eine Schweizer Zeitung zu schreiben, die über solchen Kleinkram erhaben war und ist, obwohl ja auch die Schweiz, nach dem Bekunden einiger von dort stammender Autoren, ein enges Ländchen ist: wahrscheinlich doch, trotz der verbindenden Alpen, mit etwas weiterem Horizont.