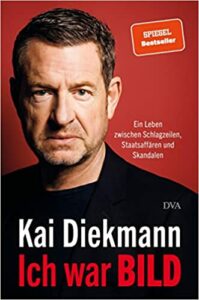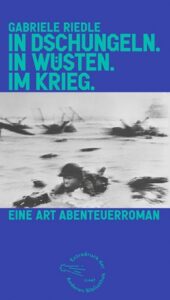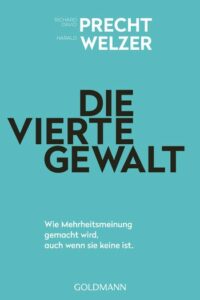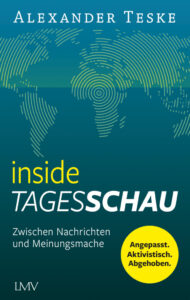
inside Tagesschau
Enthüllungsbücher haben meist einen schlechten Ruf. Man unterstellt den Autoren gerne persönliche Motive bis hin zur Rache für tatsächliche oder eingebildete Intrigen. Man liebt zwar den Verrat, aber weniger den Verräter, nicht zuletzt, weil der Leser dabei zuweilen brüsk mit seiner eigenen Desillusionierung lange gepflegter Ideale konfrontiert wird. Die Betroffenen reagieren enttäuscht bis beleidigt, manchmal, aus purer Verzweiflung, ziehen sie vor Gericht. Auch der NDR, so heißt es, prüfe derzeit gegen Alexander Teskes Buch inside Tagesschau juristische Schritte. Derweil verkauft sich das Buch gut und jeder möchte es noch haben, bevor vielleicht einige Stellen geschwärzt werden müssen.
Der Leser rätselt, welche Stellen das sein sollen. Alexander Teske ist ein Journalist, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Er arbeitete sechs Jahre (von 2018 bis Ende 2023) in der Redaktion der Tagesschau in Hamburg als »Planungsredakteur«. Vorher war er vierzehn Jahren beim MDR, der ARD-Anstalt, die, wie man im Laufe des Buches erfährt, in Hamburg aus verschiedenen Gründen keinen guten Ruf genießt. Was ein Planungsredakteur macht, wird skizziert. Auch die Hierarchien innerhalb dieses Gebildes Tagesschau bzw. ARD-aktuell bekommt man erklärt. Verblüffend: Der bzw. die Chefredakteure (Marcus Bornheim, Helge Fuhst und Juliane Leopold) haben zwar formal das Sagen, aber die wahren Herrscher über die Nachrichten sind die »Chefs vom Dienst« (von mir hier »CvD« abgekürzt), ein nicht öffentlich agierender Kreis von rund zehn Redakteuren.
Wer einmal CvD ist, bleibt dort meist bis zur Pensionierung. Männer sind überrepräsentiert (2/3 von 10 sind, lieber Herr Teske, sechs oder sieben?). Alle CvD sind älter als 45. Sie erhalten 11.434 Euro monatlich. Die meisten von ihnen haben in ihrer Laufbahn eher selten einen Fernsehbeitrag selber verfasst und wenn, dann vor sehr langer Zeit. Außerhalb von ARD-aktuell kennt sie niemand. Man wird nie erfahren, wer bei welcher Sendung CvD war. Teske nennt keine Namen, verwendet Abkürzungen (die vermutlich noch einmal verfremdet sind). Einen allerdings nennt er, »empfiehlt« sogar dessen Webseite. (Er ist seit kurzem pensioniert. Vielleicht reicht es bald noch für ein juristisch einwandfreies Impressum.) Dass eine solche Person jahrelang bestimmt hat, welche Nachrichten gesendet werden und welche nicht, lässt fast tiefer blicken als alles andere, was Teske so erzählt.
Chefredakteur vs. Chef vom Dienst
Um die CvD schwirren insgesamt mehr als 300 »Mitarbeitende« (manchmal benutzt Teske diese Sprache). Laut KEF entfielen 2021 55,7 Millionen Euro Gebührengelder auf ARD-aktuell, dem Informationskomplex der ARD, davon 12 Millionen Euro auf den Spartenfernsehsender tagesschau24, einem Sender, dessen Marktanteil je nach Altersgruppe zwischen 0,4% und 0,5% liegt und inzwischen eine Art Hobby von Helge Fuhst zu sein scheint. Bemerkenswert, dass phoenix, der »gemeinsame Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF«, im Buch keine relevante Rolle spielt, außer, dass die Redakteure aus Hamburg die tagesschau24-Kollegen einmal als »Schnarchnasen« titulieren, weil sie bei einem Thema als letzter »aufgesprungen« sind. Dieses Ignorieren könnte darauf zurückzuführen sein, dass phoenix ARD-seitig vom WDR betreut wird – und damit nicht unter der Zuständigkeit von ARD-aktuell fällt. phoenix erhält nach eigenen Angaben 37 Millionen Euro pro Jahr und hat einen Marktanteil um die 0,8%.