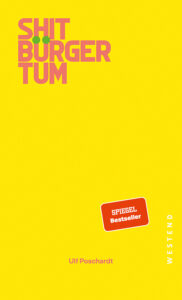Kürzlich erhielt ich eine Mail von einem leidlich bekannten österreichischen Publizisten und Kritiker, der mich für einen Wettbewerb des österreichischen Außenministeriums als »Widerpart« gewinnen wollte. Die Ausschreibung steht unter dem Motto: »Warum braucht Demokratie Literatur? Die Rolle der Kunst in Krisenzeiten.« Jeder teilnehmende Österreicher soll im Team mit einem Ausländer ihre jeweiligen »Projekte« über den Zusammenhang von Demokratie und Literatur vorstellen. Vermutlich sind Präsentationen, Workshops oder Seminare gemeint, die der Tendenz der (suggestiven) Frage des Wettbewerbs entsprechen.
Aus mehrfachen Gründen bin ich natürlich dafür der falsche. Zum einen habe ich überhaupt kein »Projekt«, Ich möchte kein Ziel erreichen, möchte niemanden überzeugen beispielsweise mehr zu lesen, oder, vermutlich wäre das noch besser, »das Richtige« zu lesen oder »das Falsche« zu meiden. Ich habe also keine Mission, bin, im wörtlichen Sinn, ein Idiot, ein Privatmann. Das ist der technische Einwand, der eigentlich jede weitere Diskussion beendet.
Ein zweite Einwand wäre grundsätzlicher Natur. Die Frage lautet nicht etwa »Warum braucht die Literatur Demokratie?« Das wäre auch töricht (siehe unten). Es geht um anderes. Genauer hingesehen ist »Warum braucht die Demokratie Literatur?« keine Frage, sondern impliziert bereits die Antwort. Es ist eine dogmatische Prämisse. Ein Zweifel ist nicht vorgesehen. Das löst bei mir Unbehagen aus.