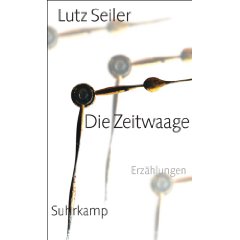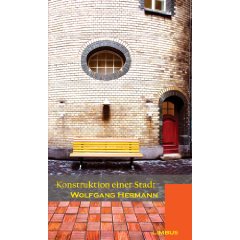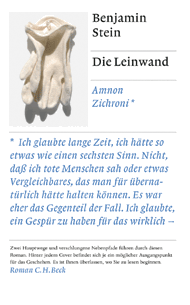
Gar nicht so einfach, mit dem Lesen dieses Buches anzufangen. Denn man hat unverhofft zwei Möglichkeiten. Entweder man beginnt mit dem Teil von und über Amnon Zichroni oder man wendet das Buch, dreht es um 180 Grad und beginnt mit Jan Wechsler. (Eine andere Idee, die Kapitel sozusagen abwechselnd zu lesen, dürfte aus Gründen der Praktikabilität fast ausscheiden; hierfür hätte man mindestens zwei Lesezeichen einbinden müssen. Und außerdem bleibt das Problem, wo man beginnt.)
Beide Teile sind fast paritätisch. Man ahnt: Wie man es auch beginnt – es bleibt eine Entscheidung, die die Rezeption prägen wird. Man wird nie erfahren, wie es gewesen wäre, wenn man anders begonnen hätte. Vielleicht werden einmal die Leser von Benjamin Steins Buch »Die Leinwand« anhand ihres Anfangskapitels unterschieden zwischen Zichroni- oder Wechsler-Einsteiger. Ob sich die beiden Lager jemals miteinander verständigen können? Tatsächlich dürften sie zwei unterschiedliche Bücher gelesen haben. Und dieses scheinbar so spaßige Spielchen passt am Ende erstaunlich gut zu Atmosphäre und Intention dieses Buches.

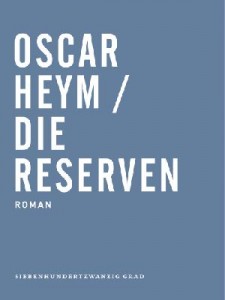
 In
In 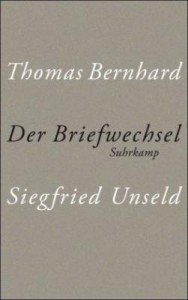 Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.
Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.