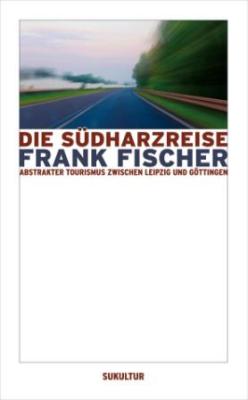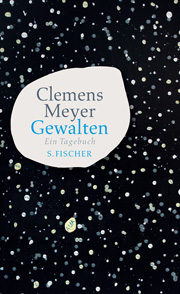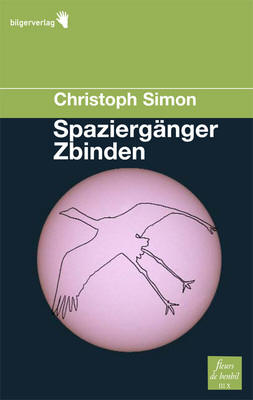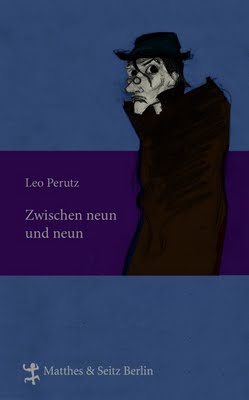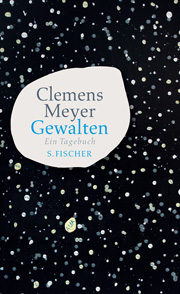
Eine wilde, alptraumhafte Erzählung von einem Mann, der an ein Bett gefesselt, fixiert ist und gerade deshalb schier ungeahnte Kräfte bekommt, beginnt mit dem Bett zu reiten, es bewegt sich sogar und er schreit. »Gewalten«. Dabei Gedankenflut, Galopprennen, Bars, besonders das »Brick’s«, die ewigen 89er, die zur Nikolaikirche pilgern. Leipzig also. Hilflosigkeit, Verzweiflung gepaart mit Trotz und Auflehnung. Eine Schwester kommt, er spuckt ihr ins Gesicht (eine Kunst aus dieser Entfernung und diesem Winkel) und sie kommen mit einem Kissen, welches sie ganz langsam auf sein Gesicht legen und etwas Warmes schießt in seinen Arm, Erinnerung an New York, den Maler Paule Hammer (sein Bild »AUA« ist das Cover des Buches) und später dann ein Ich bin noch da, ihr Schweine.
Eine neue Geschichte, einige Monate später. Der Leser erfährt über die Zwischenzeit nichts. Der Erzähler will sich mit einem Mann am Leipziger Bahnhof treffen, einem Interessenten für Filmdrehbücher. Die ganze Szenerie im Bahnhof ist nahezu kafkaesk, der Agent sucht das schlechteste Café aus, spricht leise, man fachsimpelt über Filme, Regisseure, Peckinpah, Bogdanovich, Szenen, beide sind Kenner, der Fremde verlässt das Café für zehn Minuten und kommt plötzlich mit einer Mappe wieder. Dann ein Schnitt. Plötzlich in seinem verdunkelten Zimmer, sozusagen vergraben, Bilder an der Wand, die grinsen, Abu Ghraib, Guantánamo und die Geschichte von K. Ein moderner K. und der Erzähler erleidet mit, die Demütigungen. Reminiszenz an Charlie Chaplin in »Modern Times« in den riesigen Zahnrädern und dann die Realitäten der Wohnung, die Zigaretten, die er wegspült und dann kurz danach sucht, ob er nicht eine daneben geworfen hat. Der Fall K. als »M.A.S.H.«-Film? Gedanken zum Islam, zum Glauben (ich kann das nämlich nicht mehr), Goethe und sein Respekt vor dem Koran (große Dichtung!). »My film is Guantánamo« wird Coppola paraphrasiert. Und dann verschmelzen alle Figuren, die privaten, die Leute auf den Fotografien, die Frau, die einen Häftling aus Abu Ghraib an der Leine führt und plötzlich ist er K., sieht sich Verhörleuten gegenüber; deliriert. Die Entspannung dann: das Gefühl, in seinem Zimmer beobachtet zu werden, wie in einem »Bernstein« eingeschlossen.
Weiterlesen ...