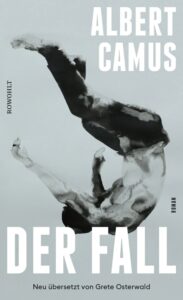
Er nennt sich Jean-Baptiste Clamence, lebt in Amsterdam und hat sich in der Matrosenkneipe Mexico-City im Amsterdamer Stadtteil Zeedijk, nahe zum Rotlichtviertel, eingerichtet. Hier spricht er Touristen an, verwickelt sie in seine Lebensgeschichte, erzeugt Neugier. Auf diese Weise trifft sich fünf Tage lang ein Rechtsanwalt aus Paris mit Clamance; beide, wie es einmal heißt, »Kinder des Jahrhunderts«. Die Treffpunkte variieren: das Mexico-City, beim Spazierengehen, auf einem Schiff, einer Insel und schließlich bei sich zu Hause. Das ist das Setting für Der Fall, Albert Camus’ 1956 erstmals erschienener Roman, der nun in einer neuen Übersetzung von Grete Osterwald vorliegt.
Dabei ist schon die Genrebezeichnung schwierig, denn die knapp einhundert Seiten stellen eher eine Erzählung dar. Aber auch stimmt nur teilweise, denn man liest nur den Monolog von Clamence, der dem Anwalt seine Lebens- und Moralgeschichte vorträgt. Gelegentliche Einwürfe des Gegenüber erfährt man nur dadurch, dass Clamence sie wiederholt und dann darauf eingeht. Im Nachwort verweist Iris Radisch auf eine Tagebuchstelle von Camus, der dieses literarische Verfahren als »eine Technik des Theaters (den dramatischen Monolog und den impliziten Dialog), um einen tragischen Komödianten zu beschreiben« spezifiziert. Aber worin besteht diese Tragik?

