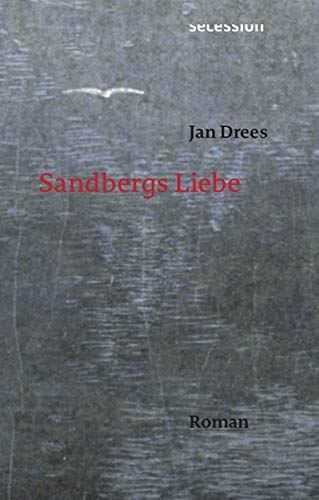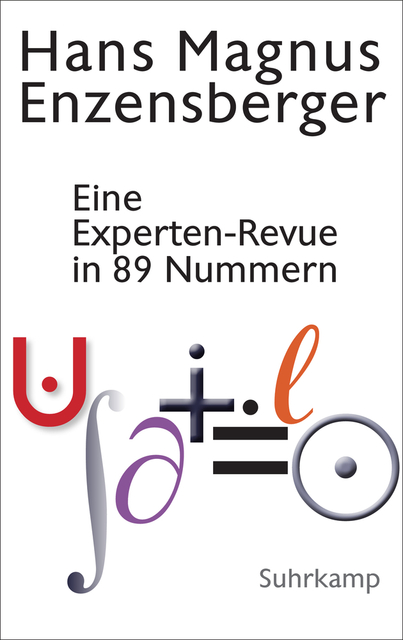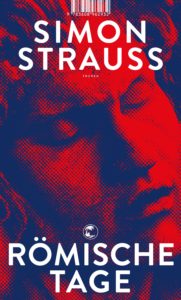
Römische Tage
Ein 1. Juli, ein männlicher Ich-Erzähler, Mitte 30, Ankunft in Rom, »zweihunderteinunddreißig Jahre und acht Monate nach Goethe«. Also ein Schriftsteller, der da schreibt? Ein Stipendiat etwa? Irgendwann ist von einem Notizbuch die Rede. Aber auch von einer Vorstandssitzung, so als kenne sich der Erzähler damit aus. Man erfährt zu Beginn von einer Flucht, um »die Gegenwart abzuschütteln«. »Rom als Heilanstalt«. Heilung von was?
Einzug in die Via del Corso, »ein Zimmer schräg gegenüber von der Casa di Goethe, Goethes Haus«. Wieder diese Referenz. Und er ahnt sie, die Klischees, das Zerrbild von Rom, all dieser berühmten Orte, Straßen, Plätze, das Bekannte, dass schon alle gesehen haben, und dass er, der »Leidenstourist« auch sehen möchte und zwar so, wie es noch nie jemand gesehen hat. Der Wunsch nach der Naivität des ersten Blicks. Es gibt viel Topographie und viel Geschichte in diesem Buch. Und ein Nachdenken, Sinnieren über das, was man Gegenwart nennt und was im Ansichtigwerden dieser modernen Metropole mit deren Jahrtausende alten Bauwerken kontrastiert. Etwa wenn er den Ort von Caesars Ermordung rekonstruiert und parallel dazu das gegenwärtige Stadtbild beschreibt.
Besonders zu Beginn ist der Grundton des Buches wie schon in »Sieben Nächte« von einer trotzigen Wehmut bestimmt. »Sieben Nächte«, jenes Buch, das zu einem Literaturskandal wurde, weil es nicht den erwünschten Mustern einer politisch-identitätsgläubigen Zeitkritik entsprach. Das Vermissen des Dionysischen als unerträglich empfundene Provokation. Man suchte daher fast verzweifelt bis hin zur Sippenhaft nach Indizien für den Duktus der »Neuen Rechten«. Im Verlauf dieses Versuchs einer Ehrabschneidung zeigten sich deutlich die Vorboten einer (Literatur- und auch Kunst-)Kritik, die sich auf das Absuchen verbotener oder mindestens »umstritten« deklarierter Termini konzentriert, die notfalls so lange dekontextualisiert werden, bis die Anklageschrift »passt«.