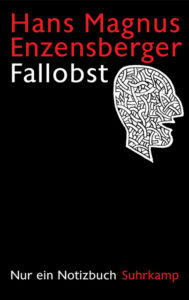
Fallobst gehört, wie man nachlesen kann, zur Kategorie »Wirtschaftsobst«. Damit wird Obst bezeichnet, welches als Tafelobst »nicht geeignet«, aber dennoch und zur weiteren Verarbeitung oder Zubereitung vorgesehen ist (wie z. B. als Most). Wenn jemand wie Hans Magnus Enzensberger seine Notatensammlung als »Fallobst« bezeichnet, ist das ein wenig eitel. Was durch den Untertitel »Nur ein Notizbuch« fortgesetzt wird.
Es ist ein umfangreiches Notizbuch mit mehr als 360 Seiten, bisweilen aufgelockert von Illustrationen des 2011 verstorbenen Bernd Bexte, dem Enzensberger am Schluß eine kleine Hommage widmet. Die einzelnen Notate sind nicht datiert; mit etwas detektivischem Gespür lässt sich der Zeitraum irgendwo zwischen 2012 und 2018 verorten. Die Unterteilung in drei »Körbe« (der erste umfasst dabei fast 300 Seiten) wirkt etwas mysteriös. Gegen Ende werden die Notizen etwas ausführlicher.
Besonders zu Beginn gibt es sehr viele Zitate. Der Grundton der eigenen Notate ist heiter und launig. Da sind etymologische Sprachspiele, die bisweilen in Listen münden. Beispielsweise über »Suchtgefahren« – d. h. Hauptwörter, die mit »-sucht« ergänzt werden können, oder auch »Lüste« auf »-lust«. Oder Suche nach Wörtern, die etwas mit »Spitzen-« zu tun haben. Aufgaben, die man Gymnasiasten stellen könnte. Hübsch diese kurze Abhandlung über die Kunst des »Schwurbelns«. Und es gibt sogar eine Aufzählung von besonders »gelungenen« Schlagerreimen. Begriffe wie »Hoheit«, »salopp« oder auch das inzwischen inflationär verwendete »gut aufgestellt« werden aufgespießt (er würdigt en passant die Journalistin Gabriele Göttle für ihr Sprachgefühl).



