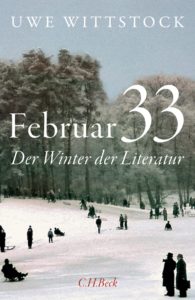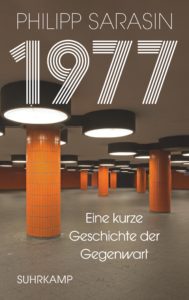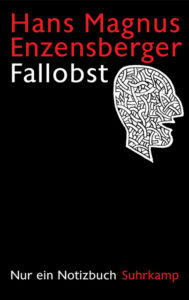Die norwegische Polit-Serie »Occupied« (deutsche Ergänzung: »Die Besatzung«) von 2015 spielt, wie es zu Beginn heißt, in einer nicht fernen Zukunft. Der wichtigste Punkt dieser hochgelobten Serie wird gleich am Anfang in einem Halbsatz abgehandelt: Die USA ist nicht mehr in der NATO. Das Bündnis spielt daher im weiteren Verlauf keine Rolle mehr. Der norwegische Ministerpräsident Berg will sein Wahlversprechen einlösen, gegen den globalen Klimawandel vorangehen und stoppt alle Gas- und Öllieferungen an die EU. Als Alternative wird die sogenannte »Thorium«-Technik vorgestellt; eine Art grüner Atomstrom (pikanterweise ist hier Bergs Frau involviert). Der Widerstand gegen diese unabgestimmte ad-hoc-Maßnahme ist in Europa verständlicherweise sehr groß. Auch Russland hat kein Interesse an ein sofortiges Ende der fossilen Energie. In einer Allianz zwischen der EU und Russland wird Druck auf Norwegen aufgebaut (nur zur Erinnerung: Norwegen ist nicht Mitglied der EU und ist es auch in der Serie nicht).
Aber Russland geht weiter. Man besetzt norwegische Förderanlagen und Bohrplattformen, um die Weiterversorgung zu betreiben. Es scheint so, als sei dies mit der EU abgestimmt. Berg wird zu Beginn kurz entführt und auf eine Änderung seiner Thorium-Politik eingeschworen. Das lehnt er zunächst ab, beugt sich dann jedoch und fährt die fossilen Ausbeutungen wieder hoch. Russland findet immer neue Details, um ein festes Abzugsdatum hinauszuzögern. Als sich ein Widerstand formiert, tritt man als Schutzmacht auf – für Norwegen und die Energieversorgung der EU. Berg wird fast schlagartig zum Realpolitiker, spielt die russische Intervention offiziell herunter. Minister treten zurück und man legt auch Berg den Rücktritt nahe, aber da die Partei in der Nachfolgefrage zerstritten ist, bleibt er. Zum Gegenpart der Regierung wird die russische Botschafterin Sidorova – andere russische Politiker weigern sich mit Berg zu reden (nur einmal kommt der Außenminister kurz ins Spiel).
Eine weitere Hauptfigur ist der Sicherheitsmann Hans Martin Djupvik, der zu Beginn der russischen Botschafterin das Leben rettet und nun sukzessive innerhalb des norwegischen Inlandsgeheimdienstes PST aufsteigt. Mehr als einmal wird er als Vermittler zwischen Russland und Norwegen eingesetzt – was allerdings mit der Zeit ermüdet. Schließlich wird er von Berg als Doppelagent eingesetzt; diese Szenen überzeugen nicht. Auch der Investigativjournalist Thomas Eriksen wirkt mit seiner ewigen Umhängetasche ein bisschen klischeebeladen.
Interessant ist die Serie, an der unter anderem auch der Beststellerautor Jo Nesbø mitgeschrieben hatte, im Aufzeigen der politischen Eskalationsspirale. Die zunächst eher marginalisierte Unabhängigkeitsbewegung »Fritt Norge« (»Freies Norwegen«), die heimlich von der unheilbar kranken PST-Chefin Arnesen unterstützt wird, erhält immer mehr Zulauf. Gelungen ist die Darstellung des zunächst auf Ausgleich mit Russland bedachten Regierungschefs, der glaubt mit Entgegenkommen die Russen schnell zum Abzug bewegen zu können. Durch gezielten Terror, der auch vor der Ermordung eigener Landsleute nicht zurückschreckt, sabotieren die Russen jedoch jeglichen Ausgleich. Später wird Berg bekennen, dass man seine sozialdemokratische Sicht auf Politik missbraucht hat.