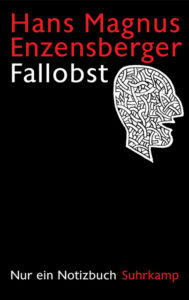
Fallobst gehört, wie man nachlesen kann, zur Kategorie »Wirtschaftsobst«. Damit wird Obst bezeichnet, welches als Tafelobst »nicht geeignet«, aber dennoch und zur weiteren Verarbeitung oder Zubereitung vorgesehen ist (wie z. B. als Most). Wenn jemand wie Hans Magnus Enzensberger seine Notatensammlung als »Fallobst« bezeichnet, ist das ein wenig eitel. Was durch den Untertitel »Nur ein Notizbuch« fortgesetzt wird.
Es ist ein umfangreiches Notizbuch mit mehr als 360 Seiten, bisweilen aufgelockert von Illustrationen des 2011 verstorbenen Bernd Bexte, dem Enzensberger am Schluß eine kleine Hommage widmet. Die einzelnen Notate sind nicht datiert; mit etwas detektivischem Gespür lässt sich der Zeitraum irgendwo zwischen 2012 und 2018 verorten. Die Unterteilung in drei »Körbe« (der erste umfasst dabei fast 300 Seiten) wirkt etwas mysteriös. Gegen Ende werden die Notizen etwas ausführlicher.
Besonders zu Beginn gibt es sehr viele Zitate. Der Grundton der eigenen Notate ist heiter und launig. Da sind etymologische Sprachspiele, die bisweilen in Listen münden. Beispielsweise über »Suchtgefahren« – d. h. Hauptwörter, die mit »-sucht« ergänzt werden können, oder auch »Lüste« auf »-lust«. Oder Suche nach Wörtern, die etwas mit »Spitzen-« zu tun haben. Aufgaben, die man Gymnasiasten stellen könnte. Hübsch diese kurze Abhandlung über die Kunst des »Schwurbelns«. Und es gibt sogar eine Aufzählung von besonders »gelungenen« Schlagerreimen. Begriffe wie »Hoheit«, »salopp« oder auch das inzwischen inflationär verwendete »gut aufgestellt« werden aufgespießt (er würdigt en passant die Journalistin Gabriele Göttle für ihr Sprachgefühl).
Allgegenwärtige Abkürzungen sind für Enzensberger Zeichen eines »Snobismus der Eingeweihten«. Besonders bissig geraten einige Medienbeobachtungen (etwa wenn er knapp aber deutlich die ZDF-Nachrichtensendungen abwatscht). Man erfährt etwas über seine Lektüreeindrücke von Blaise Pascal, Montaigne, Nicolas Chamfort, Balzac und Lichtenberg und bekommt eine Rezension (oder ist es doch keine?) über einen »Wald- und Wiesenmaler« zu lesen. Seltener sind Anekdoten, wie etwa über Henry Kissinger. Bei Persönlichkeiten wie Frank Schirrmacher und Wolfgang Pohrt, die inzwischen verstorben sind, bleiben seine zum Teil schneidenden Bemerkungen stehen (beispielsweise über Pohrts Abwesenheit, die ja krankheitsbedingt begründet war). Pohrt schätzt er nicht wegen sondern trotz seines deutschen Selbsthaßes (die Bemerkungen hierzu sind äußerst interessant).
Enzensberger schwärmt vom Englischen Garten, philosophiert über die Gretchenfrage, den Markt, die verschiedenen Kapitalismen, die Kunst des Rückzugs und sorgt sich um »verschwundene Arbeit«. Mit Urteilen spart er nicht. So ärgert er sich über die Geldpolitik der EZB (die er als »Schwindel« apostrophiert), bezeichnet Bertelsmann als »Krake«, hält Intelligenz für »keine moralisch relevante Eigenschaft«, erkennt eine Parallele zwischen NSA und IS, findet die Belle-Epoque »schauderhaft«, legt sich mit der Psychoanalyse an (»Die Seele durch die Psyche zu ersetzen war keine gute Idee«), wettert gegen Bestrebungen zur Abschaffung des Bargelds, findet Diktatoren »monumentale Langweiler«, definiert das Seefahren als »kriminell« und beklagt spöttisch den unaufhörlich in Medien niederprasselnden »Betroffenheitsregen«. Wirklich gekonnt ist seine Polemik gegen Physiker als die Märchenerzähler unserer Zeit.
Manchmal wird es redundant. So wurde man schon im letzten Buch hinreichend belehrt, wie erniedrigend Flughafenkontrollen sind. Und auch die Einlassungen über »das Internet« nebst Überforderung des Menschen durch die neuen Techniken sind in dieser Pauschalisierung weder neu noch originell. Immerhin ist Enzensberger bei allem Ärger klug genug, die Ambivalenzen in seinem Handeln zu erkennen: Schimpfend über das »Netz« ist er auch jemand, der es gleichzeitig verwendet – insbesondere die Onlineenzyklopädie Wikipedia. Zuweilen haben Enzensbergers Einwürfe etwas ausgestellt-querulantisches.
Es überwiegen jedoch die luftigen Bemerkungen. Niemand kann derart souverän von der Bedeutungslosigkeit von Gedichten schreiben als der Lyriker Enzensberger (gemeint ist natürlich das Gegenteil). Für die Postmoderne hat er nur noch das Adjektiv »ekelerregend« und begründet dies in einem Gedicht (!): »Meinetwegen // macht ruhig so weiter. // Aber ohne mich.« Das ist natürlich Koketterie. Denn in Wahrheit ist er immer noch da. Und mittendrin. Glücklicherweise.
Nicht alles, was da an Obst heruntergefallen ist, mag munden. Aber es ist trotzdem mindestens unterhaltsam. Denn langweilig – das war Enzensberger noch nie.
