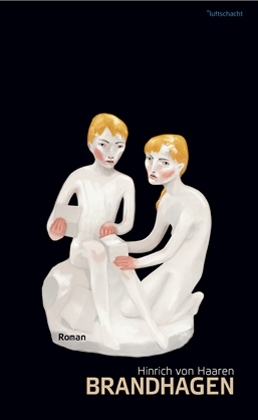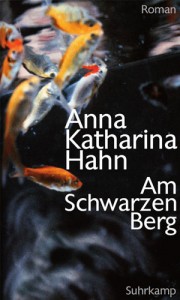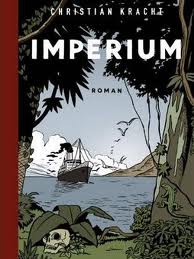Um es gleich vorweg zu nehmen: »Brandhagen« ist ein im besten Sinne bemerkenswertes Buch. Erzählt werden 12, 13 Jahre einer Kindheit Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre. Die ersten Erinnerungen des Ich-Erzählers setzen vielleicht mit drei oder vier Jahren ein; am Ende ist er 15 oder 16. Alles spielt sich in dem norddeutschen (fiktiven) Dorf Brandhagen ab. Weiterlesen
Ablehnung aus dem Jenseits?
Ja, man ist geblendet vom »Flirren der Vitrinen«, wenn man im Museum der Moderne beim Deutschen Literaturarchiv in Marbach den Raum der Dauerausstellung betritt. Ich hatte mich bis zum Schluß nicht an dieses Lichtgewitter gewöhnt und konnte mich auf die schier zahllosen Reliquien Ausstellungsstücke, die die deutschsprachigen Dichter der Neuzeit vor- oder hinterlassen haben, kaum konzentrieren. So hatte ich auch dieses Stück zunächst nicht beachtet: Weiterlesen
Anna Katharina Hahn: Am Schwarzen Berg
Kein Störer, nirgends oder: Das Elend der Ereignislosigkeit
Christian Kracht hatte in Zürich aus seinem neuen Buch »Imperium« gelesen. Und alle gingen hin. Aber sie gingen nicht nur hin. Sie berichteten auch. Alle warteten auf den Skandal, den Eklat. Leider blieb er aus. Der Autor hatte sich schon vorher Fragen nach der Lesung verbeten. Schade für die angereiste Journalistik von Spiegel, FAZ, Süddeutsche Zeitung und dpa. Was nun, da doch nichts passiert war?
Egal sagt sich das Feuilleton. Wenn man schon mal da ist, muss man auch darüber schreiben. Wobei es eigentlich nichts Unergiebigeres gibt als über eine Lesung zu berichten. Der Spiegel macht aus der Not eine Tugend: »Jetzt sprach er«, heißt es ebenso großkotzig wie ungenau. Stefan Kuzmany erzählt zunächst von seinem Abendessen und gibt sich als nicht besonders gut informiert, was er durch ständiges »oder so ähnlich« unterstreichen möchte. Dabei hat er das inkriminierte Buch wenigstens angelesen, was man daran merkt, dass er den Duktus Krachts zu imitieren sucht, wenn auch unbeholfen. »Keine Klärung« vermeldet der Reporter dann am Ende. Der Trost für den Leser: Links daneben kann man »Imperium« direkt im Spiegel-Shop bestellen. Weiterlesen
Phraseologische Betrachtungen über diverse Ängste
Es gibt Buchtitel, die im Laufe der Zeit immer wieder paraphrasiert, variiert, parodiert und karikiert werden und somit von der Sentenz zur Redensart geworden sind (oder umgekehrt) wie Johannes Mario Simmels »Es muß nicht immer Kaviar sein« oder Heinrich Bölls »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« (hier gibt es noch mehr Beispiele). Zweifellos gehört »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« dazu. Dabei handelt es sich um eine Erzählung von Peter Handke aus dem Jahr 1970 (und zwei Jahre später von Wim Wenders verfilmt wurde). Die Tatsache, dass Nichtlesern dieses Büchleins die Bedeutung des Titels nicht deutlich werden kann (Titane wie Oliver Kahn finden es »komisch«, dass ein Torwart Angst vor [sic!] vor einem Elfmeter haben soll, ist doch längst Konsens, dass ein Torwart immer nur zum Helden werden kann – sofern er den Ball hält), hält sie nicht vor Inspirationen der Verballhornungen ab.
Beim genauen Hinsehen zeigt sich, dass die meisten Variationen nicht der Intention des Handke-Titels entsprechen. Kongenial und eng an der »Vorlage« sind Schöpfungen wie »Die Angst der Torfrau beim Elfmeter« und »Die Angst des Roboters beim Elfmeter«. Auch in »Die Angst der Schäfer bei der Lammung« wird die Gleichzeitigkeit von Angst und Ereignis deutlich.
Paraphrasiert wird der Titel jedoch fast immer falsch Weiterlesen
Unter Deutern
Christian Kracht: Imperium
Als die Geschichte beginnt, ist August Engelhardt auf einem Schiff die dünnen Beine übereinanderschlagend und einige imaginäre Krümel mit dem Handrücken von seinem Gewand wischend grimmig über die Reling auf das ölige, glatte Meer schauend. Man ist am Anfang des 20. Jahrhunderts und der Ort, der angepeilt wird, heißt Herbertshöhe. Deutschland hat Kolonien.
August Engelhardt hat es tatsächlich gegeben. Einigen gilt er als »erster Aussteiger«. Die Einschätzungen differier(t)en zwischen Visionär und Spinner; Tendenz zum letzteren. Engelhardt war nach »Deutsch-Neuguinea« aufgebrochen, erstand dort eine Kokosnussplantage (mit diebischem Vergnügen wird erzählt, wie er bereits beim Kauf übers Ohr gehauen wird), gründete einen »Sonnenorden« und pflegte seinen »Kokovorismus«, d. h. eine Art Kult um die ausschließliche Ernährung durch die Kokosnuss. Er tat dies meist splitternackt, wobei die Inselbewohner diese Zivilisationslosigkeit des Migranten zwar schockierte, von ihnen aber großzügig toleriert wurde. Leider hatte Engelhardt überhaupt kein merkantiles Talent (was forsch als Kapitalismuskritik umgearbeitet werden konnte), plagte sich zusehends mit leprösen Schwären, wurde am Ende wahnsinnig und starb dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg. So weit, so gut. Aber es geht – wie fast immer – nicht nur um Fakten, es geht um Literatur. So dichtet Kracht seinem Roman-Personal einiges an, verquirlt es mit tatsächlich Geschehenem und etlichen Anekdötchen und das in einer manieriert-barocken Sprache, einer Mischung aus Elfriede-Jelinek-Duktus und »Prospero’s Books« von Peter Greenaway mit einer Prise Robinson-Crusoe-Abenteurertum (man beachte die Personalie Makeli, Engelhardts »Freitag«, der am Schluss dann Faust II und Ibsens »Gespenster« in deutscher Sprache vorgetragen zu würdigen weiß). Abgerundet wird dies mit einem schönen Umschlag im Tim-und-Struppi-Look (und irgendwie an Michael Ondaatjes neuem Buch erinnernd). Weiterlesen
Martin von Arndt: Oktoberplatz
Sehnsuchtsort Hrodna
Natürlich kommt von Arndt bei dieser Konstellation nicht ganz an alkoholgeschwängerte Atmosphäreneinheiten vorbei. Die Männer haben eben großen Durst und allabendlich ziehen sie von einem Haus zum nächsten und sprechen sich die Lage des Landes schön. Istváns Leber soll beträchtliche Ausmaße gehabt haben. Dieses bizarre Wimmeltheater der Welt um Hrodna erinnert zuweilen an ein Potpourri aus Magrebinischen Geschichten und der seligen Kohlenrauch-Gemütlichkeit von Andrzej Stasiuks Medziborie (wobei Hrodna als literarischer Ort nach der Lektüre von »Oktoberplatz« mindestens ebenbürtig betrachtet werden muss). Aber glücklicherweise werden Stilisierungen wie auch peinliche Idealisierungen im Keim erstickt.