
Aber es ist natürlich mehr. Fast schwärmerisch erzählt, nein: frohlockt Handke von den Momenten in diesen Gedichten, »wo das spezielle Geschichtswissen übergegangen ist in etwas Universelles, die Ahnung«.

Aber es ist natürlich mehr. Fast schwärmerisch erzählt, nein: frohlockt Handke von den Momenten in diesen Gedichten, »wo das spezielle Geschichtswissen übergegangen ist in etwas Universelles, die Ahnung«.
Bei einer Literatur-Veranstaltung in einer Buchhandlung im Friedenauer Dichterviertel sprach die Referentin – eine berühmte Professorin übrigens – so rhetorisch brillant wie unterhaltsam über Thomas Mann und seine Familie und erwähnte dabei einen Zigeuner auf dem gelben Wagen. Das Publikum bestand ganz überwiegend aus jungen und weniger jungen Seniorinnen und Senioren besten, alteingesessenen Westberliner Bildungsbürgertums, sowie Studierenden der Literaturwissenschaften, und etliche schienen einander zu kennen. Man war eingeladen und aufgefordert, nach dem Vortrag zu diskutieren und Fragen zu stellen. Ich fragte nach dem »Zigeuner«, erfuhr, dass es sich um ein Zitat von Thomas Mann handle und erwiderte, dass es schön gewesen wäre, wenn sie das Zitat kenntlich gemacht hätte, weil der Begriff »Zigeuner« problematisch sei, worauf die Professorin sich sofort der nächsten Wortmeldung zuwandte, die ein anderes Thema betraf.
Hinterher schenkte der Buchhändler Wein aus, und eine jener bildungsbürgerlichen jungen Seniorinnen prostete mir zu mit den Worten, sie sei froh, dass ich das Zigeuner-Zitat angesprochen hätte, denn das Zitat sei falsch. In Wahrheit sei der Wagen grün und nicht gelb! Das könne man nachlesen, sie wisse es bestimmt. Wir nippten am Wein, sie trank weißen, ich roten. Auch dies sei sicher ein interessanter Aspekt, gab ich zu, jedoch sei es mir um etwas anderes gegangen, nämlich um den Begriff »Zigeuner«, der … und wurde unterbrochen damit, dass der Wagen aber wirklich grün …
Merkwürdige Koinzidenzen: Da werde ich aufmerksam auf ein Buch von Martin Doll mit dem Titel »Fälschung und Fake«. Fast gleichzeitig wird auf »phoenix« der Film von Miklós Gimes über Tom Kummer ausgestrahlt (»Bad Boy Kummer«). Kummer hatte in den 1990er Jahre Furore mit Interviews insbesondere von US- und Hollywood-Berühmtheiten wie Brad Pitt, Sharon Stone, Quentin Tarantino oder Mike Tyson gesorgt, bis sich schließlich herausstellte, dass diese Gespräche gefälscht waren und niemals stattgefunden hatten. Diese beiden Ereignisse – die Buchlektüre und der Film – wurden flankiert von einem Beitrag des NDR-Medienmagazins »zapp« über sogenannte autorisierte Interviews. Schon vor einigen Wochen war mir in diesem Zusammenhang ein »tagesschau«-Blog-Beitrag von Sandra Stalinski aufgefallen, in der sie über ein nachträglich zurückgezogenes Interview schreibt und dies mit dem »Recht auf das gesprochene Wort« rechtfertigt, welches, wie die Autorin betont, in Deutschland gelte. Und schließlich gab es den Artikel in der FAZ, in der die Bundespressekonferenz beim Nachrichtenmagazin »Spiegel« einen Verstoß gegen das Schweigegelübde mit dem jovial-ominösen Titel »Unter 3« ausmachte und eine »Rüge« aussprach: Der »Spiegel« berichtete über eine private Aussage des Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts, der als Vorwegnahme eines Urteilsspruchs ausgelegt werden könnte.
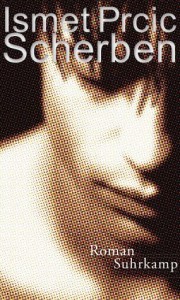
»Scherben« ist ein sehr gut konstruiertes Buch mit einfach nachvollziehbaren Vor- und Rückblenden. Zum einen wird die Eingewöhnung des bosnischen Flüchtlings Ismet Prcić in den USA erzählt. Es wird zitiert aus dem Tagebuch und Briefen an seine Mutter (wobei offen bleibt, ob diese Briefe jemals verschickt werden). Und schließlich gibt es irgendwann immer häufigere, realistische, landserartige Berichte vom Frontsoldaten Mustafa Nalić, einem Jungen, dem der Ich-Erzähler bei der Musterung begegnet und im Laufe des Buches zu Ismets Schatten, seiner zweiten Existenz wird. Er fabuliert die Lebensgeschichte von Mustafa und als er dessen Grab entdeckt, erspürt er, dass Mustafa tatsächlich noch lebt. Alles dies erlebt der Leser als therapeutische Maßnahme, die Ismet von seinem amerikanischen Arzt »verordnet« wurde um seine posttraumatische Belastungsstörung irgendwie in den Griff zu bekommen. »Jeder ist der Held seiner eigenen Märchen«, so paraphrasiert Ismet seinen Arzt – und handelt danach: »Mach dir keine Gedanken, was wahr ist und was nicht, damit machst du dich nur verrückt. Schreibt einfach nur. Schreib alles auf.«
Die Berichterstattung in den deutschen Medien über den großen Erfolg der sogenannten »Abzocker-Initiative« des Unternehmers Thomas Minder in der Schweiz ist intensiv. Aber sie ist oft falsch und schlichtweg zu einfach. Statt das Publikum über die Inhalte der Schweizer Initiative aufzuklären, werden griffige Formeln gefunden, die mit der Realität nur wenig zu tun haben.
Die Neue Zürcher Zeitung macht diese komplexitätsreduzierende Berichterstattung in »kleineren« Medien aus. Dazu gehört aus Schweizer Sicht offensichtlich die »Welt«, die mit ihrer Schlagzeile »Managergehälter sollen in der Schweiz künftig gedeckelt werden – so haben die Bürger des Landes entschieden« mangelnde journalistische »Finesse« zeige, so die NZZ. Immerhin hat man dort inzwischen die Schlagzeile verändert.
Die mangelnde journalistische Finesse ist besonders deutlich im deutschen Fernsehen bzw. deren Online-Angeboten.
Kurz nach der Publikation seines Erstlingsromans »Menschenkind« 1979 hatte Josef Winkler einen weiteren Text für die Literaturzeitschrift »manuskripte« geschrieben und veröffentlicht. Er erscheint heute, nach mehr als 30 Jahren, »neu durchgesehen« vom Autor, erstmals als Buch. Aus »Das lächelnde Gesicht der Totenmaske der Else Lasker-Schüler« wurde »Wortschatz der Nacht«, was schade ist, denn der ursprüngliche ...
Frank Schirrmachers »Ego – Das Spiel des Lebens« ist eine wilde Alarmmaschine und kapituliert allzu voreilig
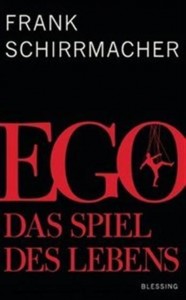
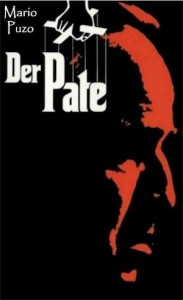
Das Cover von »Ego – Das Spiel des Lebens« weckt Assoziationen an Mario Puzos Buch (und auch dem Film) »Der Pate«. Hier wie dort das Symbol der Manipulation: die Marionette. Am Ende zitiert Schirrmacher den französischen Schriftsteller Paul Valéry, dessen Figur Monsieur Teste die »Marionette« getötet hatte. Man muss genau lesen: Hier soll nicht die Marionette emanzipiert und von ihren Fäden befreit werden. Hier geht es um den Tod der Figur. Erst wenn diese tot ist, hat der Marionettenspieler keine Macht mehr. Das bemerkenswerte ist: Die Marionette sind wir selber bzw. das, was im Laufe der Zeit Besitz von uns genommen hat. Der Tod der Marionette ist, so kann man das interpretieren, die Exorzierung des Bösen in uns. Ob da der Satz Die Antwort war falsch als Slogan der Austreibung ausreicht?
Worum geht es? Schon früh das Bekenntnis, das Buch bestehe letztlich nur aus einer einzige[n] These, die des »ökonomische[n] Imperialismus«: Damit ist gemeint, dass die Gedankenmodelle der Ökonomie praktisch alle anderen Sozialwissenschaften erobert haben und sie beherrschen. Den Keim für diese Entwicklung zum »Ökonomismus« (das ist meine Formulierung, die womöglich ungenau ist, aber vielleicht gerade in ihrer Vereinfachung vorübergehende Hilfestellung bietet) findet Schirrmacher im Erfolg der Spieltheorie, die, so die These, den Kalten Krieg sozusagen gewonnen habe. Als das planwirtschaftliche System obsolet wurde, ahnte niemand, welche Auswirkungen dies haben würde. Die Physiker wechselten an die Wall Street und implementierten die Logik des Kalten Krieges in die Maschinen, die dann ab den 1990er Jahre immer mehr den Privatraum der Menschen eroberten.
Der neue Kalte Krieg
Im Kalten Krieg galt das »Gleichgewicht des Schreckens«. Wer den atomaren Erstschlag auslöste, musste damit rechnen, ebenfalls vernichtet zu werden. Zuerst zuschlagen hieß, als Zweiter vernichtet zu werden. Der Erstschlag bot keinen Gewinnanreiz. Dieses Szenario musste immer wieder neu angestrebt und als Prämisse etabliert bleiben bzw. werden. Damit war klar: Keiner würde riskieren, die Welt untergehen zu lassen, wenn er selbst dabei draufginge. Und das ist daraus nach 1990 geworden: Keiner wird riskieren, uns untergehen zu lassen, wenn wir dafür eine ganze Welt in den Abgrund stürzen, war 50 Jahre später nachweislich die Logik der Too-big-to-fail-Strategen von Lehman bis AIG.
