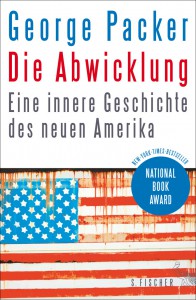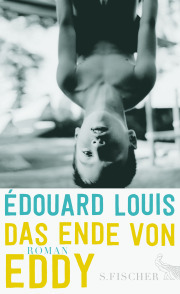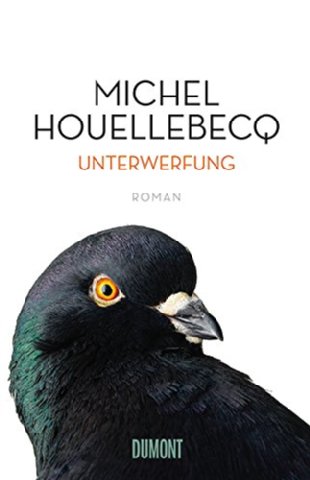Was ist »Abwicklung«? Es ist, so Packer, die »Abwicklung der Normen«, das, was man Deregulierung nennt, was zu einem Zurückentwickeln des Mittelschichtversprechens der USA führt. Und mit ihm verschwindet die institutionelle Kultur der Demokratie der Mittelschicht, die einmal so kongenial beschrieben wird: »General Motors, der Gewerkschaftsbund AFL-CIO, der ständige Ausschuss für Arbeitsbeziehungen, der Chef in der Stadt, Bauernverbände, die Bezirksverbände der Parteien, die Ford-Stiftung, der Rotary Club, die Frauenliga, CBS News, der ständige Ausschuss zur wirtschaftlichen Entwicklung, die Sozialversicherung, das Amt für Bodenschätze, das Bau- und Wohnungsamt, das Gesetz zur Schaffung des Autobahnnetzes, der Marshall-Plan, die NATO, der Rat für internationale Beziehungen, das Studienförderungsgesetz für Veteranen, die Armee.« Allgemein nennt man so etwas »Gesellschaftsvertrag«. Das Versprechen: Harte und ehrliche Arbeit bedeutete ökonomischen Wohlstand und adäquate Partizipation an und in der Gesellschaft, so das Ideal. Stattdessen ging die berüchtigte Schere immer weiter auseinander. An Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey, Peter Thiel oder Sam Walton skizziert Packer die Ausnahmen: Sie wurden zu Milliardären, obwohl die Voraussetzungen auch hier nicht immer gut waren. Weiterlesen
Wie man sich von sich selbst befreit
Édouard Louis hieß ursprünglich Édouard Bellegueule, und gerufen wurde er »Eddy«. So steht es im autobiographischen Roman, den der Autor 2012 in Paris veröffentlichte, und auch in der Wirklichkeit verhält es sich so. »Schönmaul«, mit diesem Namen ist das Kind gestraft; die entsprechenden Wortspiele werden gleich zu Beginn des Romans zitiert. Édouard Louis, 22, hat sich von den Fesseln seiner Herkunft befreit, indem er dieses Buch schrieb. Die Befreiung hat auch einen finanziellen Hintergrund, denn der junge Autor entstammt einer Schicht, die man als neues Lumpenproletariat bezeichnen könnte, und sein Erstling war in Paris ein Bestseller. Die Vorgeschichte seiner Befreiung kann man in Das Ende von Eddy nachlesen. Schon der Titel weist darauf hin: Eddy Bellegueule gibt es nicht mehr. Die Niederschrift und Veröffentlichung des Romans ist gleichbedeutend mit seiner Vernichtung.
En finir avec Eddy lautet der Titel im Original. Hinrich Schmidt-Henkel, ein außerordentlich gewandter Übersetzer, der viele sprachliche Register zu ziehen versteht, bildet den von Louis häufig zitierten nordfranzösischen Soziolekt geradezu lustvoll nach – beim Titel scheint er mir aber etwas schmähstad gewesen zu sein (oder hat ihn ein Lektor behindert?). »Schluß mit Bellegueule« würde passen und käme dem Original näher. Die Erzählung selbst hat etwas Gewalttätiges, nach dem Selbstverständnis des Autors handelt es sich um Gegengewalt gegen das gewalttätige System. Die davon Betroffenen und (im Buch) Beschriebenen beziehen die literarische Gewalt aber auf sich selbst: Der will uns vernichten! Mitsamt seinem Eddy will Louis auch die Umgebung zerstören, in der er aufgewachsen ist, also die konkreten Menschen im Dorf Hallencourt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Literatur gegen Verrohung. Verrohung gegen Literatur, gegen die Schwulen, gegen die Weicheier. Weiterlesen
Fritz J. Raddatz
Fritz J. Raddatz ist tot. Wirklich? Oder ist es nur Spiel von ihm, die heuchlerischen Nachrufe für ein neues Buch zu sammeln? Man kennt das von Kindern, die sich nicht genügend geliebt fühlen und dann erleben möchten, wie Eltern und Freunde sie auf ihrer Beerdigung beweinen. Die Lektüre der Tagebücher von Raddatz vermittelte mir einen ähnlichen Eindruck: Hier war ein Mensch, der geliebt werden wollte für das, was er der Literatur gegeben hatte – als Kritiker, Mit-Verleger, Herausgeber, Autor. Eine Vielseitigkeit, die verstörte und durchaus offene Flanken bot. Gerne krittelte man an ihm herum und wenn nichts mehr ging, dann eben an seinem Habitus. Er erinnerte eher an einen Protagonisten aus dem 19. Jahrhundert. Raddatz war einer der Letzten einer rapide aussterbenden Zunft. Einer Zunft, die man inzwischen nur noch Betrieb nennt. Seine Exaltiertheit, sein Berserkertum, sein Salon-Sozialismus – Gegensätze, die Schubladendenkern unheimlich waren. Akzeptiert sah er sich mehr in Frankreich als in Deutschland. Was einiges über Deutschland aussagt.
Raddatz bestand darauf: Er ist ein Intellektueller. Er wollte sich nicht gemein machen mit Massenmedien und überließ das Feld anderen, etwa seinem Antipoden Marcel Reich-Ranicki. Aber im Gegensatz zu Reich-Ranicki verriss Raddatz nie Autoren, sondern maximal deren Literatur. Angriffe auf die Autorenperson gab es bei ihm nicht. Schwierig in einer Welt, in der Literatur nur noch personalisiert rezipiert und bewertet wird und ästhetische Kriterien wenig zählen.
Besonders gerührt in seinen Tagebüchern haben mich die Stellen, in denen er große Romane der Literatur wiedergelesen hatte. Das erstaunliche daran: Kaum eines dieser Bücher, die sein Leben so nachhaltig prägten, hielten der Lektüre im Alter stand. Bei Montaigne machte er noch ein Fragezeichen, eindeutig dagegen die Verdikte zu Virginia Woolf (»seelische Spitzenklöppelei«), Tolstoi, Proust (»schwer erträgliche geschmäcklerische Zierlichkeit« bzw. »etwas Frisörhaftes«), Balzac (»mickrig«), Döblin, Walter Benjamin (Zweifel an dessen »Beträchtlichkeit«), Joseph Conrad und Thomas Bernhard (»Literatur-Clown«). Selbst das Monument Thomas Mann, dessen Tagebücher er genussvoller findet als einen »Coitus« (mit »C«!), bleibt nicht ganz verschont. Die »Buddenbrooks« bestehen noch, aber den »Felix Krull« findet er doch arg »Rokoko-verzuckert« und erkennt, dass der Ich-Erzähler unmöglich die Bildung haben kann, die sich in dessen Wortwahl zeigt. Die »Wahlverwandtschaften« sind für ihm nur ein Unterhaltungsroman; Goethe wird bei ihm zum »Stephen King avant la lettre«. Typisch Raddatz dann das Gran Selbstkritik: »Oder liegt das Desinteresse nur an mir?«
In seiner Autobiographie »Unruhestifter« legte Raddatz seine Kindheit und Jugend offen. Dabei nannte er Namen; die Menschen sollten einstehen für das, was sie ihm – im Guten und im Bösen – angetan hatten. Dabei teilte sich die Rezeption seiner autobiographischen Werke: Die einen unterstellten ihm Wehleidigkeit und Larmoyanz. Die anderen bewunderten die Schonungslosigkeit auch sich selbst gegenüber. Tatsächlich habe ich verglichen mit dem, was in der Betroffenheitslounge so mancher Medien reüssiert, in seinen Schilderungen kaum ein Jammern vernommen. Die Erzählungen all dieser Kränkungen und auch körperlichen Nötigungen in seiner Jugend wirkten immer eher unterkühlt, deskriptiv. Mitleid wollte Raddatz nicht.
Die Nachrufe werden triefen vor Bigotterie und Verlogenheit. Die Adjektive »umstritten« oder »streitbar« werden Hochkonjunktur haben; Euphemismen, die zumeist von Leuten benutzt werden, die entweder keine Ahnung haben oder Pharisäer sind. Man wird seine Tucholsky-Arbeit loben, die Erfindung der »rororo«-Reihe herausstellen, seine zahlreichen Interviews preisen. Vielleicht sogar sein Romanwerk entdecken. Eines wird unterbleiben: Die Aufzählung seiner Preise. Es sind nur zwei – einer aus Frankreich und dann 2010 der Hildegard-von-Bingen-Preis. Raddatz hat das gekränkt. Dabei hätte es ihn eigentlich stolz machen müssen.
Marc Degens: Fuckin Sushi
Niels hat einen Bass. René eine Gitarre und Ideen für Texte, die »roh und hart und ehrlich« sind. Beide gründen eine Band: »R@’n’Niels« (René ist R@ = »rat«). Eines Sonntags fahren sie, um sich in Bonn nicht zu blamieren, nach Bad Münstereifel und spielen dort vor dem Heino-Café. Der Erfolg ist überschaubar, aber die Saat keimt. René gelingt es, den sechs Jahre älteren Lloyd zu begeistern. Von nun an haben sie einen Schlagzeuger und Fahrer in Personalunion. Vor allem jedoch einen Probenraum – in einem Turm. Später kommt noch die Punkerin Nino mit ihrem Keyboard hinzu. Aus dem Bandnamen »Funking Sushi« wird schließlich »Fuckin Sushi«. Es geht um »Weltfrieden und Abrentnern«. Die Logik ist verblüffend: Warum nicht nach der Schule mit der Rente beginnen, Musik machen, tagsüber Fernsehen (»Kochsendungen, Zooreportagen, Hallenfußball oder Sommerbiathlon«) und erst dann, so ab 50, mit dem Arbeitsleben beginnen? Weiterlesen
Joachim Zelter: Wiedersehen
Nach mehr als zwanzig Jahren lädt der unkonventionelle Deutschlehrer Thorsten Korthausen – von Ferne erinnert er an John Keating aus dem »Club der toten Dichter« – seinen einstigen Musterschüler Arnold Litten zu einer kleinen Party nach Hause ein. Arnold ist inzwischen ein angesehener Germanistik-Professor. Auf der Fahrt erzählt er seiner Freundin Anna die Besonderheiten und Extravaganzen Korthausens. Zum Beispiel dessen erste Deutschstunde in der Privatschule für »ausnahmebedürftige Schüler«, dieser »Ansammlung von Aufsässigkeit und Lustlosigkeit«. Niemand nahm den neuen Lehrer zur Kenntnis. Schließlich beteiligte dieser sich an einer Schachpartie, die während des Unterrichts gespielt wurde. Ein vergnüglich zu lesender Anekdotenstrauß prasselt da auf den Leser ein. So wird von Korthausen eine Klassenarbeit Arnolds mit »Eins bis Sechs« benotet – weil sie sowohl sehr gute wie auch ungenügende Passagen enthält. Ein andermal dann mit »Eins plus plus«. Oder die Sache mit dem Hund: Korthausen erzählt Wunderdinge von seinem Hund, den er eines Tages mitbringt und die Aufsicht bei einer Klassenarbeit vornehmen lässt. Der Hund sei aggressiv und belle sofort wenn geschummelt würde. Die Schüler sind eingeschüchtert und wagen keine Manipulationen. Am Ende eröffnet Korthausen ihnen, dass er den Hund aus dem Tierheim geholt habe. Oder dieser Schüler, der in vielen Fächern Fünf stand und dann Vieren bekommt, weil er mit Korthausen einen strammen Waldlauf durchsteht. Weiterlesen
Literaturkritik versus Literaturjournalismus
Jörg Sundermeier, Chef des Verbrecher-Verlags, sorgte mit seinem Interview im »BuchMarkt« vom 25.01. für einiges Aufsehen. In einer Art heiligem Zorn beklagte er den Niedergang der Literaturkritik. Im Teaser zum Interview wird auf ein Kolloquium über Literaturkritik am 30.01. in Mainz hingewiesen. Dabei lohnt ein Blick auf die Vortragenden; unter anderen wirken mit: Sandra Kegel, Uwe Wittstock und Hubert Winkels. Drei Kritiker, die mehr als nur eingebunden sind in genau den Betrieb, den es kritisch zu hinterfragen gilt. Rainer Moritz, der das Kolloquium moderierte, versuchte auch sogleich Sundermeiers Einwände zu relativieren, in dem er zwar einige Probleme einräumte, aber das Gesamturteil dann doch nicht bestätigen wollte.
Nun ja, es ist verständlich, dass der Hang zur Selbstreflexion nicht sehr ausgeprägt ist. Exemplarisch sei hier Sandra Kegels Kurztext zu ihrem Vortrag angeführt, um die Reflexionstiefe der Kritikergilde insgesamt aufzuzeigen. Sie schreibt: »Dass wir uns in einem kulturellen Sinkflug befinden, ist immer häufiger zu hören, der Niedergang des bürgerlichen Feuilletons wird allenthalben beklagt, insbesondere bei der Königsdisziplin Literaturkritik. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.«
Weiterlesen auf Glanz und Elend
Michel Houellebecq: Unterwerfung
Michel Houellebecqs Roman »Unterwerfung« wurde nicht zuletzt wegen der wenn auch länger zurückliegenden kritischen, zum Teil durchaus beleidigenden Äußerungen des Autors zum Islam argwöhnisch untersucht. Die Koinzidenz zwischen der Erstveröffentlichung und den schrecklichen Morden von Paris liegt natürlich außerhalb des Einflusses des Autors. Was einigeR Hysteriker nicht davon abhält, Houellebecq von nun an eine Art Mitverantwortung für das Vergangene bzw. sogar das Zukünftige zuzuweisen. Dabei ist spätestens seit Rushdies »Satanischen Versen« klar, dass Terroristen, Politiker und die meisten Medienvertreter bei allen Differenzen in einem Punkt eine Gemeinsamkeit haben: Sie brauchen das Werk bzw. die Reaktionen darauf, die sie skandalisieren und instrumentalisieren nur als Anlass; eine Lektüre ist dann doch zu aufwendig. Das hat in erschütternder Weise die Diskussion in Frankreich gezeigt, in der Houellebecq die Verbreitung rechtsextremer Thesen und sogar Rassismus vorgeworfen wurde.
Auch in Deutschland überschlugen sich die Rezensenten bereits vor Erscheinen des Buches mit ihren Urteilen. Dabei wurde auch hier mit Akribie auf eine potentielle Islamfeindlichkeit des Textes bzw. des Autors geachtet, was abermals zeigt, dass das Feuilleton zunehmend die Rolle des politischen Anstandswauwaus wahrnehmen möchte, weil sich damit am meisten Distinktion erarbeiten lässt. Noch seltsamer als dieser Gesinnungs- und Rezensionswettlauf mutete die zuweilen aufkommende (gespielte?) Naivität an, die fragt, warum eigentlich alle jetzt plötzlich ein literarisch derart mittelmässiges Buch besprechen. Dabei spielt es keine Rolle, dass das Urteil der literarischen Mediokrität fast immer nur behauptet wird; handfeste Belege fehlen zumeist.
Verstopfte Waschbecken und Fehler in der Steuererklärung
Der Plot des Romans ist schnell erzählt. Der Leser wird transformiert in das Frühjahr des Jahres 2022. François, ein müder französischer Universitätsprofessor an der Pariser Sorbonne, bald 44 Jahre alt, der über Joris-Karl Huysmans dissertiert hatte, weiß nicht mehr so recht, was er tun soll: »Mein Interesse für das Geistesleben war sehr abgeflaut, meine gesellschaftliche Existenz war nicht zufriedenstellender als meine körperliche, die eine wie die andere war eine Abfolge kleiner Widrigkeiten – ein verstopftes Waschbecken, eine nicht funktionierende Internetverbindung, Strafpunkte für schlechtes Fahren, betrügerische Putzfrauen, Fehler in der Steuererklärung -, die mich ohne Unterlass quälten und nie zur Ruhe kommen liessen.« Seine Liebesaffären sind im Semesterrhythmus getaktet. Nur mit der halb so alten Myriam verbindet ihn mehr. Weiterlesen
Horror-Wohnungen
TAGEBUCHAUFZEICHNUNG JANUAR 1989
3. Januar, Dienstag: (...) Ich erledige Einkäufe, lese Limonov1, hole ihn dann um ½ 12h von zuhause ab. Wie grausig er wohnt, in der Rue de Turenne! Diese winzigen zwei Zimmerchen! Die Uralt-Schreibmaschine. Die revolutionären Plakate an den Wänden. Eine Zeichnung, comix-artig, von einer Asiatin, Sekunden bevor sie womöglich erschossen werden wird. Sie bettelt um Gnade. AHHH, OHHH!
Wir sprechen ein wenig ad seinen Büchern, seinem Leben. Sein Gesicht halb Baby-Face, halb alter Mann. Er schreibt auch auf Englisch, aber normalerweise Russisch. Sein Nicht-Zusammenseinwollen mit anderen Exilrussen. Der Vater offenbar KGB-Polizist. Seine Liebe zu einer Roten-Armee-Jacke, so tauchte er ja damals auch in Wien auf2...Sein Plan, vor 5 Jahren, ein Buch über Gaddafi zu schreiben – sein Interesse für den libyschen Revolutionsführer. (...) Der Weihnachtsbaum in seiner Horror-Wohnung überrascht mich. Sein Wesen viel lockerer, freundlicher, offener als zuletzt. Ein sypathischer, interessanter Zeitgenosse. Seine Kurzmonologe eigentlich immer meaningful. Kein langweiliger Mensch. Und seine bizarre Biographie. Führe ihn in die Wohnung, die L.3 und ihr Assistent in ein Studio verwandelt haben – und von 12h – 17h wird Eduard abgelichtet. Zwischen den Aufnahmen unsere Gespräche – sehr gutes Material bereits, z.B. ad 21. August 19684, sein Streit mit dem (verhaßten?) Vater. Eduard Limonov strotzt von Leben und Kraft, mit seinem nackten, muskulösen Oberkörper. (...) Ich fühle mich vergleichsweise muskellos, müde, verkühlt, die Schultern lasse ich hängen... Weiterlesen
Eduard Limonov, russischer Schriftsteller, geboren 1944. Heute ultrarechter Politiker in Moskau, Gründer der Nationalbolschewistischen Partei Russlands. Siehe auch den 2012 erschienenen Roman "Limonov", von Emmanuel Carrère. ↩
Gemeint ist eine Konferenz der Exilschriftsteller, 1988, während der ich Limonov kennengelernt hatte. ↩
Lillian Birnbaum fotografierte Limonov für das Magazin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", ich schrieb dazu den Text. Unser Artikel erschien am 24. Februar 1989. ↩
Der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei. ↩