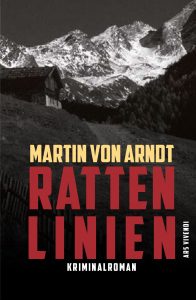Unlängst konnte man lesen, dass bei der Besiedlung des Mars durch Erdbewohner (optimistische Planungen sehen dies ab 2025 vor) auf Häuser verzichtet werden muss. Meteoritenschauer, Sandstürme, Temperaturschwankungen und Weltraumstrahlungen machen dies unmöglich. Stattdessen müssten die Erdlinge in Lavahöhlen und ‑kratern leben, die es auf dem roten Planeten auch in grösserer Anzahl zu geben scheint. Ein berühmter Architekt hat hierzu bereits entsprechende Entwürfe vorgelegt. Am Ende des vermutlich größten technologisch-zivilisatorischen Aktes der Menschheit wäre der Homo sapiens wieder ein Höhlenbewohner.
Es ist eher unwahrscheinlich, das Botho Strauß beim Schreiben seines neuen Buches »Oniritti – Höhlenbilder« dieses Bild vor Augen hatte. Er definiert Oniritti als »Bildschriften auf der Höhlenwand der Nacht«, erwähnt einen Gedanken von André Leroi-Gourhan über die Höhlenbilder von Lascaux, schickt den Leser gleich zu Beginn in das »Unterirdische Reich Agharti« und danach nach »Idle City«, dem »Märchenreich der gebrechlichen Seelen«, phantasmagoriert von »geheimen Grotten« und entdeckt ein »Hadesäquivalent«.
Die Höhle, bei Platon einst Sinnbild für das unfreie Individuum, ist hier nicht mehr der Ort der Manipulation und des (falschen) Scheins, sondern wird zum Exil der letzten (denkenden) Menschen umgewertet. Erklomm Zarathustra den Berg so haust Strauß in der Höhle. Die Schatten- und Trugbilder findet er in einer anderen, einer virtuellen Welt, die die reale Welt zu usurpieren droht oder bereits usurpiert hat. »Schon verstrickt oder nur vernetzt« lautet denn auch leicht süffisant einmal die Frage. Der Vernetzte ist der Gefangene des 21. Jahrhunderts und Rückzug die neue Bürgerpflicht. Weiterlesen