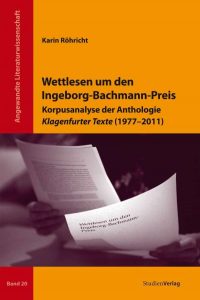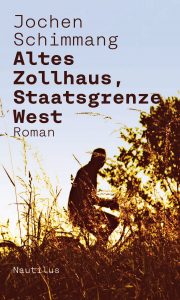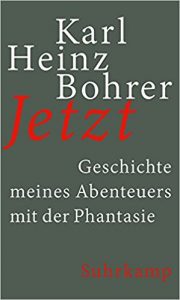Niemand beachtet sie mehr, die Kirschbäume, seit sie ihre Blüten verloren haben. Damals, in der kurzen Blütezeit, waren sie die Stars: in Scharen drängten sich die Leute um ihre Stämme, ließen sich nieder unter der – what you’d say? – weißen Pracht, lachten, tranken aus Bierdosen, lachten...
Einst bildeten sie eine Allee, jetzt stehen sie im Abseits, kaum einer weiß, daß sie die sind (und nicht mehr sind), die sie waren. Könige einst, jetzt Durchschnittsgestalten mit langweiligen Blättern, nicht groß nicht klein, nicht dick nicht dünn, nicht dunkel nicht hell, sondern rundlich, pummelig, Einheiten für die Statistik, die niemanden interessiert. Sie tragen keine Früchte, spenden löcherige Schatten, die keinen Schutz bieten. Ihr Holz soll hart und formbar sein, aber wir können es nicht nutzen, dürfen die Bäume nicht fällen und neue pflanzen, weil wir die – what you’d say? – kurze Pracht ihrer Blüte brauchen für unser irdisches Vergnügen im nächsten und übernächsten Jahr.
© Leopold Federmair