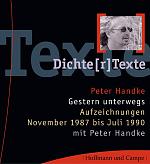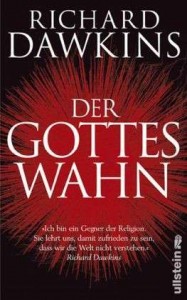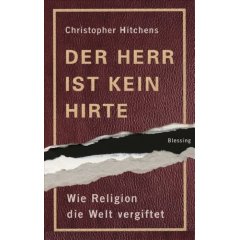
In dem Film »Modern Times« (»Moderne Zeiten«) von 1936 muss der Arbeiter Charlie (gespielt von Charlie Chaplin) mit zwei Schraubenschlüsseln laufend Schrauben anziehen. Charlie verinnerlicht diese immergleichen Fliessbandbewegungen so stark, dass er irgendwann diese auch an den Brustwarzen, Nasen oder Hinterteilen seiner Kollegen, an irgendwelchen Knöpfen, an Hydranten – und schliesslich auch an vorbeiflanierenden Frauen wie der Sekretärin des Chefs und einer korpulenten Dame auf der Strasse ausüben möchte. Charlie sieht überall nur noch Schrauben. Alles muss von ihm festgeschraubt werden. Er steht vor dem Wahnsinn; die Monotonie seiner Arbeit hat seine Sinne vorübergehend deformiert.
Arbeitsverhältnisse wie 1936 gibt es kaum noch. Dennoch kann es auch heute noch passieren, dass eine einseitige Ausrichtung einer Tätigkeit zu der Ausblendung dessen, was man vielleicht ‘vollständige Wahrnehmung’ nennen könnte, führen kann. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dies bei dem Journalisten Christopher Hitchens der Fall ist. Hitchens’ selektive Wahrnehmung dokumentiert sein Buch Der Herr ist kein Hirte.