Der Germanist Alan Keele stellte neulich fest: Walter Kempowski hatte aus persönlichen Gründen in den Jahren 1947/48 Kontakt mit dem amerkanischen Geheimdienst CIC. (s. auch »Enthüllungsgeil«) Keele betonte, dass dies keine sensationelle Enthüllung sei, sondern nichts mehr als eine Fußnote, wenn auch eine interessante. Der F.A.Z.-Redakteur Edo Reents machte daraus eine Sensation mit dem effekthascherischen Titel »Walter Kempowski war doch ein Spion«.
Astrid Herbold: Das große Rauschen
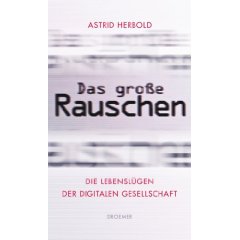
Es geht ums ganz Große: »Die Lebenslügen der digitalen Gesellschaft« will Astrid Herbold »bissig im Ton und scharf an der Analyse« (Klappentext) entlarven. Rasch wird noch das Attribut »schlagfertig« hinzugefügt und die einzelnen Mythen, die dekonstruiert werden sollen, aufgeführt. Wobei man irgendwann fragt, ob die Autorin nur die Mythen zerstört, die sie selber geschaffen hat. Aber gemach.
Nun sind (oder waren?) die Verheissungen des »globalen Dorfs«, des mobilen Zeitgenossen und der so einfachen Handhabbarkeit des virtuellen Wissens ja durchaus enorm. Technikaffine Entwickler versprechen uns à la longue immer noch das schöne, gute, einfache – das bessere Leben. Aber so manches Versprechen hat sich schon als veritable Luftblase entpuppt. Man glaubt ja längst nicht mehr an das einzig weißmachende Waschmittel. So können, ja müssen, die Entwicklungen der veränderten Kommunikationsgewohnheiten beispielsweise in Unternehmen durchaus befragt werden. Und ob es dauerhaft erstrebenswert ist an fast jedem öffentlichen Ort die intimen Gespräche anderer unfreiwillig mit zu hören, ist eine durchaus diskutable Frage.
Enthüllungsgeil
Edo Reents hat viel Schnaps getrunken und mit einem Professor eine gar tolle Enthüllung präsent: Walter Kempowski war ein Spion! Eine »Bombe« erkennt der offenbar nicht ganz trinkfeste Redakteur da und »spektakulär« schallt es aus den Feuilleton-Stuben (insbesondere der FAZ), die in ausgleichender Gerechtigkeit jetzt endlich auch einmal einen Nicht-Altlinken dekonstruieren möchte. So ganz neu sei das alles nicht sagt dann der Professor im sinnigerweise lange ins Bezahlarchiv gesteckten Beitrag, der sich beim genauen Lesen schon als Rohrkrepierer erweist (Gespräch mit Alan Keele [»Das geht ja aus den Romanen selbst hervor«]).
Der Nachklapp von heute will die taumelnde Mücke noch ein bisschen aufpeppen und behauptet noch einmal trotzig eine Banalität: Walter Kempowski hat in seinen Romanen nicht immer die Wahrheit geschrieben!
Peter Sloterdijk: Du mußt dein Leben ändern
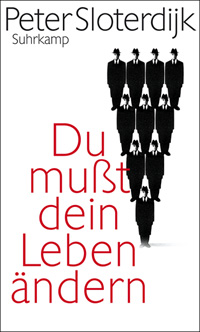
Du mußt dein Leben ändern
So wie der Torso Apollos im Louvre von Paris im Jahr 1908 zum Dichter Rainer Maria Rilke mit seiner durchlichtende[n] Äußerung des Seins in einem anthropomorphen Akt zu sprechen beginnt und ihn aufruft »Du mußt dein Leben ändern«, so möchte auch Peter Sloterdijk den Leser mitreissen und affizieren. Begeistert ob dieser (säkularistischen) Inspiration weist er in seiner höchst originellen Lesart des Rilke-Gedichts en passant auf die beiden wichtigsten Worte dieses absoluten Imperativs hin: Zum einen das »Müssen« – zum anderen das Possessivpronomen: hier sind weder Ausflüchte noch Delegationen erlaubt und die Konsequenzen könnten einschneidend sein.
Und so nimmt Sloterdijk Fahrt auf zur Lebensänderungs-Expedition. Dabei soll (in Paraphrase zu Wittgenstein) der Teil der ethischen Diskussion, der kein Geschwätz ist, in anthropotechnischen Ausdrücken reformuliert werden. So wird der Übende, der Akrobat, zur Galionsfigur des Sich-Ändern-Wollenden installiert und bekommt dabei fast zwangsläufig das Attribut »asketisch«, denn der größte Teil allen Übungsverhaltens vollzieht sich in der Form von nicht-deklarierten Askesen. Kein Ziel kann da hoch genug sein (und das im wörtlichen Sinn). Rilkes Vollkommenheits-Epiphanie als unumkehrbares Aufbruchsmoment, als Vorbild für den heutigen Trägheitsmenschen. Sloterdijk als Trainer (das ist derjenige, der will, daß ich will oder doch eher eine Re-Inkarnation Zarathustras, denn kein Zweifel kommt auf, daß hier Nietzsche der grosse Motivator ist, sozusagen der »Über-Trainer«.
Journalistenattrappen (3)
Das Interview von Horst Seehofer in der Wochenzeitung »DIE ZEIT« hat der bayerischen Staatsregierung so gut gefallen, dass sie es gleich ins Internet gestellt hat. Die Google-Suche verzeichnet es vor dem originären »ZEIT«-Text.
Dror Zahavi / Michael Gutmann: Mein Leben (arte/ARD)
Die Frage ob bzw. wie der Film das Buch nun korrekt wiedergebe oder nicht, erweist sich meist als müßig: Zu unterschiedlich sind die Medien, zu grob die Struktur des Films, die in den meisten Fällen die feinen Untertöne des literarischen Werkes nicht im Entferntesten zu entfalten vermag. Es gibt die ein oder andere Ausnahme, die sich zwar eng am literarischen Werk hält, aber dann doch ein eigenständiges Film-Kunstwerk wird ohne die Vorlage zu denunzieren, sondern sie ergänzt, ja, klarer zu macht; leider »too few to mention« (und nicht relevant für diese Betrachtung hier).
Fast selbstverständlich musste die Verfilmung von Marcel Reich-Ranickis Buchs »Mein Leben« (es werden letztlich ausser der mehr als oberflächlich eingestreuten unmittelbaren Nachkriegszeit Reich-Ranickis als polnischer Generalkonsul nur die ersten beiden Teile des Buches bis 1944 gezeigt) hinter dem doch stark beeindruckenden Geschriebenen zurückstehen. In neunzig Minuten presst man die Geschichte von 1929 bis 1944 und hastet von Stichwort zu Stichwort. Man spürt das Bemühen, Schlüsselszenen des Buches unterzubringen (was teilweise auch geschieht), aber Reich-Ranickis anekdotisches Erzählen, was dieses Buch nicht unwesentlich charakterisiert und auf verblüffende Weise stark macht, fällt dieser Ereignis-Rallye als erstes zum Opfer.
Nicholson Baker: Menschenrauch
Übersetzung: Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld
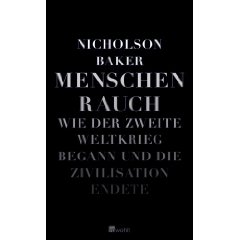
»Menschenrauch« von Nicholson Baker ist ein kühnes, ein waghalsiges, ein fürchterliches, ein aufrüttelndes, ein geschichtsklitterisches – und ein erhellendes Buch. Es ist der Versuch, die Zeit zwischen 1919 und Ende 1941 aus einer anderen Sicht zu sehen. Wo inzwischen die Vokabel des Paradigmenwechsels ein wenig verbraucht erscheint – hier ist sie angebracht.
Tagebuchähnlich collagiert, zitiert und montiert Baker aus Briefen, Artikeln, Aufzeichnungen, Büchern und Verlautbarungen von Politikern, Schriftstellern, Journalisten oder auch nur »einfachen« Bürgern (vorwiegend aus dem angelsächsischen Bereich; aus Deutschland gibt es vor allem Auszüge aus den Tagebüchern von Goebbels, Victor Klemperer und Ulrich von Hassel). Der Erste Weltkrieg wird nur auf ganz wenigen Seiten am Anfang gestreift, die Jahre 1920–1933 auf rund 30 Seiten. Der Zweite Weltkrieg beginnt auf Seite 152, das Jahr 1940 auf Seite 182 und 1941 auf Seite 306. Das Buch endet am 31.12.1941 (Seite 518; danach gibt es ein sehr kurzes Nachwort und umfangreiche Quellennachweise), also als die meisten Menschen, die im Zweiten Weltkrieg starben…noch am Leben [waren] wie Baker schreibt.
Der Gedanke, es handele sich um etwas analog zu Kempowskis »Echolot«-Projekt erweist sich sehr bald als falsch. Bakers Zitate sind fast immer bearbeitet – und er wertet, wenn auch manchmal nur unterschwellig. Nur selten wird das »reine« Dokument zitiert. Manchmal werden auch nur die jeweiligen Zitate gegen- oder aufeinander bezogen. Dieser Stil ist suggestiv bis ins kleinste Detail. So erfolgt beispielsweise keine Datumszeile, sondern es wird narrativ mit einem bedeutungsvollen »Es war der …« im Text agiert. Peinlich genau achtet Baker darauf, dass alles belegt ist; er benutzte ausschließlich öffentliche Quellen bzw. Archive.
Salman Rushdie: Die bezaubernde Florentinerin
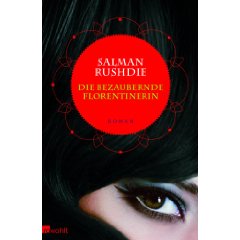
In einem Ochsenkarren kommt er daher, der gelbhaarige Fremde, ein anmutiger Narr…vielleicht aber auch gar kein Narr. Nicht sitzend sondern stehend, aufrecht wie ein Gott, im rumpelnden Gefährt geschickt die Balance haltend. Man schreibt das Jahr 1572 (laut Klappentext) und befindet sich in Fatehpur Sikri, einem Ort jenseits von Religion, Region, Rang und Stamm, der Stadt der schönen Lüge, der Hauptstadt des Reiches von Jalaluddin Muhammad Akbar, dem indischen Grossmogul, dem Weltverschlinger.
Der Fremde sei im Namen der englischen Königin unterwegs und müsse Akbar unbedingt persönlich eine Botschaft der Monarchin übermitteln. Dafür hat er die weite Reise von Europa über das Kap der Guten Hoffnung nach Indien gemacht. Zunächst geht er allerdings in ein Hurenhaus, macht Bekanntschaft mit den Huren Skelett und Matratze. Dort erprobt er erst einmal eine Salbe, die sexuelles Verlangen steigern soll, bevor die beiden Huren ihn mit speziellen Düften parfümieren. Er soll riechen wie ein König damit er die verschiedenen Instanzen am Hof entsprechend überwinden kann und auch tatsächlich zu Akbar, dem Schirmherr der Welt, vorgelassen wird.
