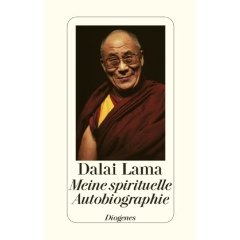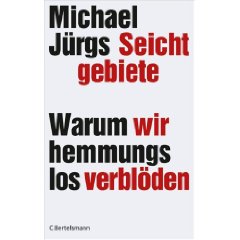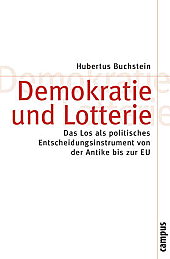Wie schön ist es, vergänglich zu sein, zu wissen, dass das Leben nicht unbegrenzt viele Tage hat? Es ist sicherlich besser, als wenn wir ewiglich existierten. Was kann man schon mit unendlich viel Zeit anfangen? Aber dass Vergänglichkeit sogar schön sein kann, ist eine Erfahrung, die ein Menschen auch erleben kann. Wenn uns der Tod etwa von grausamen Leiden erlöst, oder bestimmte Krankheiten, Probleme oder andere schädigende Sachverhalte nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden.
Weiterlesen
Dalai Lama (Tenzin Gyatso) / Sofia Stril-Rever: Meine spirituelle Autobiographie
Es wäre natürlich ein Fehler, den Zuspruch nur an Äußerlichkeiten festzumachen. So erscheint dieser Mann mit seiner natürlich wirkenden Fröhlichkeit und der im Kern (so scheinbar) einfachen Botschaft gepaart mit einer Nuance Exotismus, die eine vielleicht ernsthafte Beschäftigung mit seinen Thesen womöglich eher behindert, wie ein ferner Onkel, dem man ab und zu gerne zuhört und dessen (mediale) Anwesenheit ein wohliges Gefühl des Verständnisses erzeugt. Zumal er sich auf die Erstellung von Diagnosen beschränkt und keine Imperative aufstellt (was die Rezeption ziemlich bequem macht).
Weiterlesen
Entenwahl
Kurz nach den Kommunalwahlen konnte man im Süden Düsseldorfs plötzlich ein sehr merkwürdiges Plakat sehen:
Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass es sich um einen Hinweis zur Bundestagswahl in wenigen Wochen handeln sollte. Alleine: Welche Partei entschließt nach den gescheiterten Spaßwahlkämpfen gewisser Politiker in den Jahren zuvor, einen solchen Blödsinn als politische Aussage zu verkaufen?
Weiterlesen
Michael Jürgs: Seichtgebiete
Wer hat das nicht schon einmal erlebt? Man trifft auf einer Party einen Zeitgenossen, mit dem man sofort in vielen Punkten gleicher Meinung ist. Andere kommen hinzu und nehmen in der Debatte teilweise konträre Positionen ein. Man verteidigt den Angegriffenen. Und plötzlich holt dieser zu verbalen Rundumschlägen aus, verlässt das scheinbar so fruchtlose Argumentieren, beschimpft die Mitdiskutanten rüde und wundert sich am Ende, das niemand seine Sicht der Dinge teilt, was dann zur Bestätigung der These herangezogen wird, dass alle anderen eh’ zu blöde sind. Achselzuckend geht die Runde auseinander und mit den Schimpfkanonaden des Beleidigers ist der Kern der eigenen Überzeugung auch gleich ein bisschen mitdiskreditiert worden.
Der Volksmund hat dieses Dilemma im Sprichwort vom Ton, der die Musik macht, festgehalten. Und mehr denn je gelten im Diskurs bestimmte Gebote, die ihn überhaupt erst ermöglichen. Das bedeutsamste ist die gegenseitige Akzeptanz. Ohne das gegenseitige Anerkennen ist ein Diskurs undurchführbar. Die Regeln dieses respektvollen Diskutierens, die zunächst im informellen Gebrauch geformt werden und dann allgemeine Gültigkeit durch Gebrauch erhalten, sind in den letzten Jahrzehnten immer präziser und teilweise durchaus repressiver geworden. Zudem wurden inzwischen institutionell verankerte und sanktionierte Ge- bzw. Verbote ausgesprochen. Viele sehen daher in öffentlichen Diskussionen inzwischen immer mehr übertriebene Korrektheiten, die formale Elemente dem argumentativen Austausch unterordnen. Die Folge seien, so die These, häufig blutleere Beiträge, die sich mitunter in elaborierter Wortgymnastik ergehen. Weiterlesen
Faktor 13
Lassen wir einmal beiseite, was an den Meldungen stimmt, dass es ein geheimes Waffengeschäft zwischen Nordkorea und dem Iran gegeben hat. Interessant ist der Aufmacher auf tagesschau.de (13.30 Uhr, 29. August 2009):
Die Kartenausschnitte der jeweiligen Länder suggerieren, dass beide Staaten eine ähnliche Grösse haben. Ein Blick auf die Fakten zeigt aber etwas anderes:
Weiterlesen
Hubertus Buchstein: Demokratie und Lotterie
Der Untertitel macht neugierig: »Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU« heißt es da. Das Los als Entscheidungsinstrument kennt man eher im Sport. So werden in Fußballwettbewerben Spielpaarungen zugelost, wenn nicht jeder gegen jeden spielen soll. Meist wird es mit einer Mischung zwischen notwendigem Übel und willkommener Ungewissheit betrachtet. Der Zufallscharakter wird insbesondere von den vermeintlich besseren Mannschaften als wettbewerbsverzerrend empfunden, da schwächere Mannschaften durch entsprechendes »Losglück« begünstigt werden können; die Floskel vom »schweren« oder »leichten« Los macht dann oft die Runde. Das Weiterkommen in einem Wettbewerb wird unter Umständen nicht mehr alleine der Leistung (im Sieg über die zugeloste Mannschaft) gutgeschrieben.
Aber wäre es mit unserem Verständnis in Übereinstimmung zu bringen, politische Entscheidungen mindestens teilweise über Losentscheidungen vornehmen zu lassen? Ist nicht der Status des Gewählten für einen Amtsträger erst DIE Legitimationsbasis überhaupt? Wie würde ein »ausgeloster« Abgeordneter, Richter oder Bürgermeister akzeptiert werden? Geht es überhaupt darum, die Wahl durch das Los zu ersetzen? Oder könnten Losentscheidungen nur flankierende Maßnahmen zur rascheren Auswahl von Entscheidungsträgern darstellen? Worin könnten die Vorteile gegenüber den bisherigen Verfahren liegen? Weiterlesen
»Es gibt keine Idyllen in dieser Welt. Nirgendwo.«
Schönes Interview mit Peter Handke in den »Salzburger Nachrichten« (SN):
SN: Wünschten Sie sich, manchmal etwas oberflächlicher wahrgenommen zu werden?
Handke: Ja, Sie haben recht. Ich würd’ mir wünschen, dass einige meiner Stücke als Boulevard stücke wahrgenommen werden.
SN: Passiert aber nicht. Vielleicht auch, weil Sie ja so ein Art Heiligkeit umgibt, der Dichter jenseits von jedem, der im Wald um Paris Schwammerl sucht, sich manchmal provokant zu Wort meldet. Das ist doch nicht schön, nur so – als Schwieriger – wahrgenommen zu werden.
Weiterlesen
Jochen Schimmang: Das Beste, was wir hatten
Ein furios-melancholischer, manchmal sentimentaler Beginn. Gregor Korff, 1948 geboren, durchschreitet in Gedanken seine Kindheit und Jugend. Vom Vorharz ins Friesische gekommen, für seine Mitschüler mit einem Geheimnis [ausgestattet]…das er gar nicht hatte, entwickelt sich eine Freundschaft zu Nott (der später ein Anwalt in der linksalternativen Szene wird). Man richtet sich heimlich eine alte, baufällige Hütte ein, beschäftigt sich mit den Beatles und dem Profumo-Skandal (vor allem mit Christine Keeler), hat kurzfristig Respekt vor dem britischen Posträuber Biggs, rezitiert Beckett (den man nur teilweise versteht), spielt Schach und lässt irgendwann zwei Schwestern (die Füchsinnen) ins Refugium hinein (und Gregor erinnert sich an Reni Fuchs und seine aufkommende Lust).
Dann die Studentenzeit in Berlin (der seit Schulausflugtagen ungeliebten Stadt), die (Zufalls-)Bekanntschaft mit Lea (im Raum des Möglichen hätte ja eingangs der Party durchaus auch eine andere Blickrichtung gelegen), dadurch Gefolgschaft und Funktion in einer K‑Gruppe. Anfang der 70er Jahre geht Lea in den Untergrund (er hört nie mehr von ihr). Die Fussballtruppe der PL/PI (»Proletarische Linke/Parteiinitiative«) bleibt noch, diese seltsame Truppe von Träumern und Versprengten; für die Augenblicke des Spiels scheinen alle Probleme und Differenzen getilgt. Hier lernt er Leo Mürks kennen (das Heinrich-Böll-Gesicht), der nach Köln ging (und Uli Goergen [später Professor] und Carl Schelling). Der kommunistische Orden verliert trotz des Fussballs schnell seinen Reiz; der schleichenden Infiltration widersteht er, schreibt einen Abschiedsbrief, verlässt Berlin und geht »in den Westen« zurück.
Weiterlesen