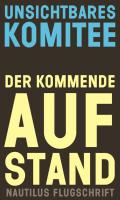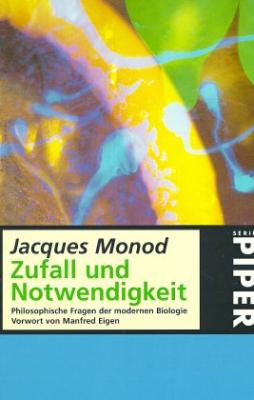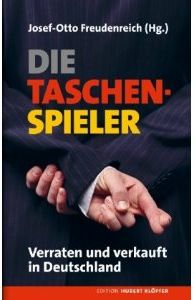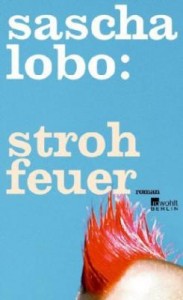Matthias Énard: Zone
Fast 600 Seiten eine Suada ohne Punkt in 21 Kapiteln (plus drei Kapitel »Zitate« aus einem fiktiven Buch aus dem libanesischen Bürgerkrieg). Kapitel, die über 40, 50 und mehr Seiten gehen – bestehend nur aus einem einzigen Satz; eine Bleiwüste, in der sich der Leser zuweilen verirrt, verirren soll, ganz schnell taucht er dort hinein, geht gelegentlich unter, behauptet sich dann doch, in dem er Stellen nochmals liest (und nicht weiß, wo er beginnen soll). Und er kann nicht ablassen von diesem inneren Monolog, den wilden Assoziationen, historiographischen Einschüben, Gedankenketten, (Liebes-)Beichten, Götterbeschwörungen, Schimpf‑, Hass‑, Ekel- und Schmähtiraden auf der Zugfahrt von Mailand nach Rom am 8. Dezember 2004, als die Fahrt noch sechseinhalb, sieben Stunden dauerte (und der »Euro Star«, der es in drei schafft, noch nicht fuhr).
Dabei wird der Leser zum Suchenden, Forschenden, fast zum Detektiv, längst bevor er erfährt, dass hier ein Söldner und späterer internationaler Spitzel sinniert. Jemand, der Mitte der 1990er Jahre nach vier, fünf Jahren kroatisch-serbisch-bosnischen Kriegen und einer kurzen Zeit im Verbannungs‑, Zuflucht- und Folterort Venedig in einen Nachrichtendienst wechseln konnte, beginnend in der Hölle Algeriens als drittrangiger Aktenführer, in einer Welt von lächelnden Schlächtern und Mördern, die Kindern die Kehle durchschnitten, mit Namen, die ich nicht unterscheiden konnte. Da hatte er die Kalaschnikow gegen weit subtilere, aber ebenso wirksame Tötungsmaschinen eingetauscht, Treibjagden, Verstecke, Verhöre, Denunziationen, Deportationen, Erpressungen, Kuhhandel, Manipulationen, Lügen, die mit Morden endeten, mit zerstörten Leben, in den Schmutz gezogenen Menschen, gebrochenen Lebensläufen, ans Licht gezerrten Geheimnissen. Von Agentenromantik keine Spur; wer hier die gängigen Klischeebildchen erwartet, soll lieber die Lektüre mit den üblichen Lesezirkel-Verdächtigen weiterführen.
-> weiterlesen bei Glanz und Elend