Die Reaktorenkatastrophe in Japan hält zur Zeit die Welt in Atem. Alles übertrieben, tönt es da aus einer Richtung. Die Journalisten sind alle indoktriniert, schüren nur Panik. Wie ein Kettenbrief kursiert seit gestern in deutschsprachigen Facebook-Accounts der Aufsatz eines gewissen Josef Oehmen, der zunächst als Wissenschaftler des MIT vorgestellt wurde, was man dann später korrigierte: Oehmen ist das, was man gemeinhin einen Risikomanager nennt.
Gregor Keuschnig
Pierre Chiquet: Der Springer
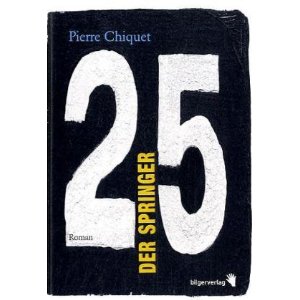
Zunächst denkt man, dass das Buch »25« heißt. Diese Zahl prangt weiß auf schwarzem Untergrund auf dem Cover. Erst auf dem zweiten Blick erkennt man den richtigen Titel, senkrecht in goldenen Buchstaben: »Der Springer«. Auf der nächsten Seite, umrissartig die »26«. Auf der vorletzten Seite »27«. Dazwischen: das Buch. Was haben die Zahlen zu bedeuten? Nach einem Drittel ahnt der Leser: Es sind Zimmernummern. In Zimmer 27 trifft sich ein Paar. Und in Zimmer 26 ist der Ehemann der Frau. Viel später erfährt man, dass das Zimmer 25 auch noch eine Rolle spielt. Es ist verwirrend.
Dabei beginnt alles so einfach: Eine tote Frau, ein Kommissar, der im sommerlichen Gewitterregen den Tatort zu Fuß aufsucht und ein zumeist schweigender Tatverdächtiger, der gesteht und danach nur noch einen Satz in einem langen Verhör sagt. Am Grab der Getöteten, wenige Tage später, erscheint dem Kommissar epiphanisch die Gestalt der Frau und auch gleich die Geschichte dazu. Es ist die Geschichte von Paulzen, dessen ehemaligen Studienkollegen Stockmann und von Madeleine, die dann Stockmanns Ehefrau wurde. Plötzlich sucht Stockmann Paulzen auf und »bietet« ihm ohne Umstände seine Frau an. Sie »entgleite« ihm und er komme mit ihr nicht mehr zurecht. Er könne sie haben.
Fragen an Frau Pohl
Ines Pohl, Chefredakteurin der taz, betont in einem Interview um die Anzeige der »Bild«-Zeitung in der taz, dass diese – »wie in jedem ordentlichen Zeitungshaus« – Redaktion und Anzeigengeschäft getrennt habe. Pohl weiter: »Die Redaktion verfügt gar nicht über die Hoheit, zu entscheiden, ob eine Anzeige erscheint oder nicht, wenn die Anzeige – das ist im Redaktionsstatut der taz festgeschrieben – nicht rassistisch, sexistisch oder kriegsverherrlichend ist.«
Die Finstermannriege
Horst Seehofer hat es nun ausgesprochen. Da ist sie: die Guttenberg-Dolchstoß-Legende. Herr Lammert und Frau Schavan sollen, so der rührige CSU-Vorsitzende Seehofer, dem Freiherren in den Rücken gefallen sein. Da ist es wieder: Dieses Zauberwort der Politik – die Geschlossenheit. »Die Reihen fest geschlossen« – nicht nur eine deutsche Tugend, aber hier immer besonders gerne hervorgekramt, wenn die Kraft des Arguments auf dem Altar des Opportunismus geopfert werden soll. Pikant ist, dass ausgerechnet Seehofer, der mit seinen undifferenzierten und plakativen Einwürfen die schwarz-gelbe Koalition immer wieder ungefragt penetriert, Minister und Abgeordnete zu Abnickern degradieren möchte.
Brigitte Schwens-Harrant: Literaturkritik – Eine Suche
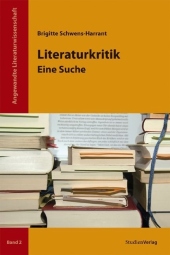
»Literaturkritik – Eine Suche« ist mehr als nur eine Momentaufnahme aus dem »Betrieb«, der sich zumeist in Jammerei und mehr oder minder offener Publikumsbeschimpfung übt, wenn es um ihr Metier geht. Brigitte Schwens-Harrant, selbst Literaturkritikerin, liefert nicht nur eine profunde, wunderbar unaufgeregte Beschreibung des Ist-Zustandes, sondern entwickelt im weiteren Verlauf nichts Geringeres als eine Zukunftsperspektive für ihre Zunft. Dies alles in lakonischer und präziser Sprache, ohne in das abschreckende, letztlich nur selbstbeweihräuchernde Germanistensprech zu verfallen, welches sie berechtigterweise bei anderen moniert.
Es gibt schöne Gelassenheitsmomente der Autorin, etwa wenn sie die allgemeine Verunsicherung in der Branche mit dem Satz Achselzucken macht munter kommentiert. Schwens-Harrant zeigt zwar Verständnis für die schwierige Situation der Kritiker (niedrige Honorare, Sparzwänge in den Zeitungen, »Gesetze« des Betriebs) sieht aber keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil: Während die Mitglieder des Literaturbetriebes damit beschäftigt sind, zu streiten, zu jammern oder einander an die Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit ihres Tuns zu erinnern, sind die Leser dabei, sich via Internet Öffentlichkeit zu schaffen und auf eigene Faust Literaturvermittlung zu betreiben. Die Frage, was der Literatur eigentlich besseres passieren kann, als auf diese Weise Aufmerksamkeit zu bekommen, ist eben nicht ironisch gemeint.
Ein schändliches Versagen
Zwei Aussagen des Verteidigungsministers zu Guttenberg am Montag auf der inzwischen fast berühmten Wahlkampfveranstaltung der CDU zum Kommunalwahlkampf (!) in Hessen sind bemerkenswert: Zum einen erklärt er seinen dauerhaften Verzicht, den Doktortitel zu führen. Und zum anderen »gestand« er einen »Blödsinn« geschrieben zu haben.
Der »Blödsinn« wurde von der Universität in Bayreuth mit »summa cum laude« bewertet. Damit gibt er der Universität und seinem Doktorvater noch nachträglich einen Tritt. Und auch die zahlreichen plagiierten Autoren werden indirekt beleidigt, denn allzu viel Eigenanteil soll die Doktorarbeit ja nicht aufweisen.
Euphemismen in der Politik – (III.) Stabilität
Die westlichen Demokratien und das Regime Mubarak haben eines gemeinsam: Beide haben Angst vor dem ägyptischen Volk. Die Bekenntnisse in den Sonntagsreden zu Demokratie, Freiheit und Menschenrechten verpuffen, wenn die Realpolitik übermächtig und »Stabilität« zum alleinentscheidenden politischen Kriterium wird. Die sorgenvollen Mienen bei der deutsch-israelischen Kabinettsitzung gestern sprechen Bände. Die USA und Israel wollen das System Mubarak erhalten. Vielleicht haben sie ihm ja eine Pille entwickelt, damit der 82jährige noch zwanzig oder dreißig Jahre lebt. Ihnen ist ein autokratischer Mubarak mit seiner »richtigen« Politik lieber als die Perspektive eines freien Landes. Als wäre es sicher, dass Ägypten wie weiland der Iran zum Gottesstaat wird (die Auguren sagen das Gegenteil).
Der deutsche Michael Moore
Einige bezeichnen Christoph Lütgert inzwischen als den deutschen Michael Moore. Es ist anzunehmen, dass dies als Kompliment gemeint ist; die Vorwürfe der Manipulation von Fakten gegenüber Moore sind ja im linksliberalen Mainstream nie mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt worden. Lütgert hat vermutlich keine Fakten verbogen. Aber wie Moore geht er äußerst suggestiv vor und personalisiert gnadenlos seine Dokumentationen. Im Maschmeyer-Film vom 12. Januar erscheint Lütgert gefühlte 20 von 30 Minuten auf dem Bildschirm. Gesten erscheinen in Großaufnahme. Zum festen Bestandteil seiner längeren Filme gehört das Selbstgespräch, in dem er den Zustand der Welt im allgemeinen und im besonderen beklagt. Mal im leeren Fußballstadion von Hannover, mal auf der Straße. Es ist unmöglich, der Meinung Lütgerts in diesen Filmen zu entkommen. Sie ist immer schon da, wird breitgetreten und in jeder Szene unterstrichen – sei es optisch oder über den Kommentar; zumeist simultan. Sogar im Titel ist schon klar: Da sind die Bösen und Galahad Lütgert erklärt uns die Welt. Der Film über den Textildiscounter »KiK« im August 2010 heißt nicht nur »Die KiK-Story« sondern bekommt sofort ein Attribut dazu: »die miesen Methoden des Textildiscounters«. Beim Maschmeyer-Film ging man es etwas sanfter an und titelte nur »Der Drückerkönig und die Politik«. Dafür heißt es dann bedeutungsvoll zu Beginn des Films: »Schurke oder Edelmann«.
Zu Beginn seines Filmes über »KiK« und geht Lütgert einkaufen. Für noch nicht einmal 26 Euro ist er komplett eingekleidet – und wundert sich, wie sowas funktioniert. Er fliegt nach Bangladesch und besucht einen Betrieb, in dem Textilien für »KiK« genäht werden. Er beschäftigt sich mit den Arbeitsbedingungen, den Löhnen und besucht eine Arbeiterin. Deren Neffe liegt im Sterben; die Familie hat kein Geld für eine Behandlung. Lütgert klagt »Das Kind stirbt«, unterdrückt mühsam seine Tränen und suggeriert, »KiK« hätte die Schuld, weil die Näherin zu schlecht bezahlt werde. (Das Kind stirbt dann nicht, sondern findet Behandlung.)
