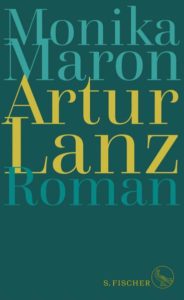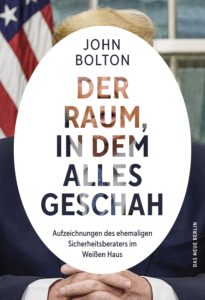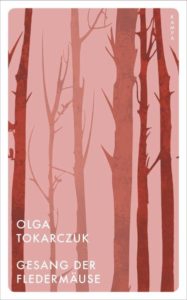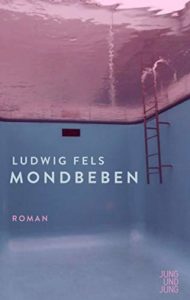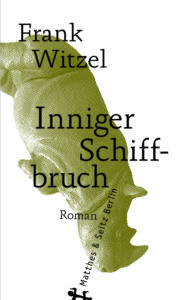
Inniger Schiffbruch
Die Kanonisierung des literarischen Genres der »Autofiktion« schreitet scheinbar voran. Mit »Inniger Schiffbruch« legt Frank Witzel, der 2015 mit seinem Buchpreis-Siegertext »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« schockierte, überforderte (zumindest mich) und zugleich beeindruckte (ebenso), einen stark autobiographischen Prosatext über das Leben seiner Eltern und – was noch entscheidend sein wird – seinen hieraus entstanden Lebensprägungen vor. Der Titel erinnert ein wenig an »Wunschloses Unglück«, wie Peter Handke 1972 seinen Versuch über den Freitod seiner Mutter (und damit über ihr Leben) zu erzählen nannte. Aber die Auflösung für Witzels Titel wird sofort in der Widmung aufgelöst: Es handelt sich um eine Formulierung im Gedicht »L’infinito« von Giacomo Leopardi, übersetzt von Rainer Maria Rilke. Später wird der Leser erfahren, dass die Eltern bei einer Italienreise in den 2000er Jahren auf Leopardi aufmerksam gemacht wurden und der Vater schließlich das Gedicht »für Alt, Klavier und Orchester« vertonte. Und warum der Musiklehrer, Chor- und Orchesterleiter Carl Witzel (Jahrgang 1930) dies getan hatte, erfahren wir auch: »In diesem sehnsüchtig verzweifelten Zeilen des Dichters, dessen ‘physisches Leben ein Martyrium war, nur von wenigen Stunden relativer Schmerzfreiheit unterbrochen’, wie es in einem von meiner Mutter ausgeschnittenen Zeitungsartikel hieß, schienen meine Eltern noch einmal unabhängig voneinander auf eine gemeinsame Sehnsucht gestoßen zu sein.«
Wer genau liest stellt sich die Frage: Worin liegt denn die »gemeinsame Sehnsucht«, die der Erzähler hier suggeriert? Im Dauerschmerz des Dichters? In den wenigen Momenten, in denen er schmerzbefreit war? In einer Art Schmerzensverwandtschaft (die Mutter wird als Schmerzensfrau [Rheuma] dargestellt)? Oder geht es um die Sehnsucht des »Schiffbruchs«, des Scheiterns?