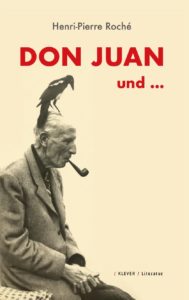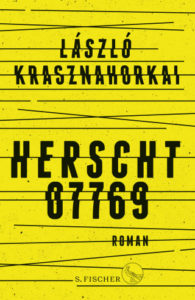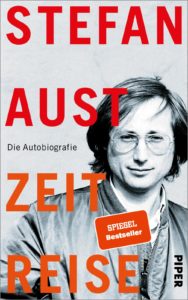Eine Bemerkungen zum Film »Kevin Kühnert und die SPD« von Katharina Schiele und Lucas Stratmann
Irgendwann 2019 trifft sich Kevin Kühnert im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung mit Philipp Amthor, dem vier Jahre jüngeren Nachwuchsstar der CDU. Die Lebensläufe ähneln sich. Beide haben ihr ganzes bisheriges Berufsleben in Gremien von politischen Parteien verbracht und dort reüssiert. Amthor hat immerhin die »Erste Juristische Prüfung« absolviert, Kühnert ist Studienabbrecher. Der aufmerksame Zuschauer erinnert sich an eine Szene im Film, dass ein Bild des Kopfes von Amthor an irgendeiner Pinnwand im Willy-Brandt-Haus im Hintergrund sehen war als sich Kühnert und seine Entourage Hochrechnungen anschauten – vermutlich als Scherzmittel. Amthor erkundigt sich, warum ein Filmteam dabei ist und Kühnert klärt ihn auf, dass dies für eine Langzeit-Dokumentation sei; geplant bis zur Bundestagswahl 2021. Er habe das auch schon mal überlegt, so Amthor, der sich vermutlich sorgen würde, dass die Privatheit zu kurz kommt. Kein Problem, klärt ihn Kühnert auf, »wenn ich sage ‘ist nicht’ – dann ist nicht«.
Genau dies muss man in den mehr als drei Stunden, den der Film »Kevin Kühnert und die SPD« dauert (ordentlich portioniert auf sechs Folgen), immer im Auge haben: Es ist die sterile Authentizität eines »Best of«, welches Katharina Schiele und Lucas Stratmann von Kevin Kühnert zwischen 2018 und 2021 mit dessen Erlaubnis zeigen. Es ist eine Simulation von Realität, ein bestimmtes Image transportierend. Gezeigt wird jemand, der permanent Medien konsumiert und sich in den Medien Präsenz verschafft, eben weil er in einer Position als Juso-Vorsitzender (bis Ende 2020) genau diese Präsenz erhält. Kühnert, der ständig unter Strom zu sein scheint, ist Akteur in einer selbstreferentiellen Kommunikationsspirale einer Politbubble, die nur einen Fixpunkt hat: Kevin Kühnert.
Er macht es den Medien leicht, ist ein dankbarer Interviewpartner, (fast) ständig verfügbar und reaktionsschnell, wenn es darum geht, Aussagen seiner Genossen und/oder des politischen Gegners schlagzeilenträchtig zu kommentieren. Wenn er den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer als »Sprechautomat« bezeichnet, so ist dies durchaus als Distanz zu den Phrasen des Politbetriebs gemeint, die Kühnert immer versucht ist, zu umgehen um eigene Punkte zu setzen.
Bei aller Inszenierung – es gibt sie eben doch, die ehrlichen Momente. Als Kühnert im Europawahlkampf in der oberbergischen Provinz vorfährt und für ein paar Stunden das Basisparfüm in einer Gaststätte einatmet, bricht er sich noch vor dem Buffet auf. Man verabschiedet ihn herzlich; er ist wirklich eine Art von Hoffnungsträger. Als die Autotür zuschlägt entfleucht ihm ein Seufzer: »Meine Güte«. Und da blitzt die Verachtung des Funktionärs dem Kleinbürger gegenüber auf.
Als er in einem ZEIT-Interview 2019 die Kollektivierung von Unternehmen als langfristiges Ziel ausgibt, um den Kapitalismus zu überwinden, kontert er den Widerspruch auch in den eigenen Reihen mit einem trotzigen »das musste mal gesagt werden« und moniert, dass der Beitrag im Netz immer noch hinter einer Bezahlschranke verborgen ist. Wenn hierzu die Interviewanfragen anderer Medien explodieren, kontert Kühnert dies mit »Aasgeierei«, weil die zu erwartenden Fragestellungen nicht nach seinem Geschmack ausfallen dürften. Wenn er könnte, würde er auch noch die Fragen an sich selber formulieren wollen. Immerhin wird der »Volksverpetzer« gelobt, der als Sidekick zu Kühnerts Pressesprecher die Interview-Passage entsprechend deutet.
Bei DWDL steht zu lesen, was Kühnert zur Dokumentation sagte: »Viele leiten ihr Verständnis von politischen Prozessen und Parlamentarismus von dem ab, was sie in Filmen und Serien sehen, während das konkrete Verständnis des eigenen nationalen oder regionalen Parlaments sehr gering ausgeprägt ist.« Weiter steht dort, er, also Kühnert, »habe zeigen wollen, ‘wie Politik aussehen kann, wenn sie nicht aus dem parlamentarischen Zusammenhang heraus kommt’ «.
Weiterlesen ...