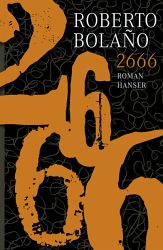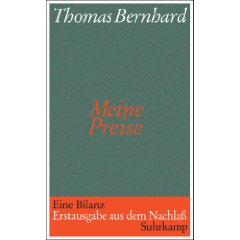Der Vorwurf des Plagiats ist der schlimmste, den man einem Schriftsteller machen kann. Daher sollte man mit solchen Beschuldigungen vorsichtig umgehen. Plagiatsgeschichten haben meist nicht nur Enthüllungscharakter. Die schlechten Enthüllungen denunzieren auch immer gleich mit. Es gibt zahlreiche Beispiele für Kampagnen, die gelegentlich durchaus die Intention hatten, Schriftsteller auch ökonomisch zu vernichten.
Die Definition von dem, was man »Plagiat« nennt, ist recht klar. Neben der rechtlichen Erklärung, gibt es auch eine ethische. Beide Interpretationen machen es so schwierig festzustellen, ob etwas Plagiat ist, ein Motiv verwandt wurde oder ob es eine Veränderung oder Weiterentwicklung eines Motives ist.
Deef Pirmasens hat in seinem Weblog »die gefühlskonserve« Helene Hegemanns Bestseller »Axolotl Roadkill« mit dem Buch »Strobo« des Bloggers »Airen« verglichen und verblüffende Parallelen festgestellt, die er ausführlich dokumentiert.