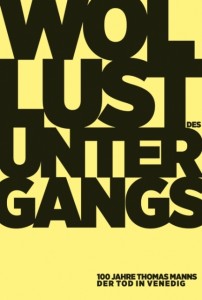Das Wunder des Überlebens
Als Ernst Lothar seine Autobiographie »Das Wunder des Überlebens« publizierte, war er 70 Jahre alt. 1890 als Lothar Ernst Müller in Brünn geboren (der Vater war Rechtsanwalt, die Mutter »hatte sich das Lachen frühzeitig abgewöhnt«), siedelte die Familie (es gab noch zwei ältere Brüder, Robert, der früh verstarb und der 1882 geborene Hanns, der später als Hans Müller-Einigen als Lyriker und Dramatiker reüssierte) 1904 nach Wien. Lothar studierte Jura und Germanistik und promovierte 1914 zum Dr. jur. Aus seinen Reiseplänen nach Ende des Studiums wurde nichts. Der Krieg brach aus. Immerhin: Lothar wurde (warum auch immer) für kriegsunfähig erklärt und zu einem Staatsanwalt als Gehilfe nach Wels versetzt. Er heiratete 1914 und die Töchter Agathe (*1915) und Johanna (*1918, genannt »Hansi«) komplettierten die Familie. Lothar hatte bereits während des Studiums mit dem Schreiben angefangen; erst Gedichte, dann Romane. Aus seiner Schriftstellertätigkeit resultiert die Änderung des Namens.
Wenn man die im Zsolnay-Verlag erschienene Neuauflage der »Erinnerungen« Ernst Lothars (so der Untertitel des Buches) gelesen hat, erkennt man drei Momente, die sein Leben nicht nur geprägt, sondern existentiell erschüttert haben. Da ist zunächst der Zusammenbruch der Donaumonarchie Österreich-Ungarn 1918. Aus 53 Millionen werden plötzlich nur mehr 7 Millionen, die sich Österreicher nennen (durften). Die »Macht und Herrlichkeit ohne Beispiel« der »Vereinigten Staaten von Europa« – so euphorisch wird er im Rückblick – ist zerstört. Jetzt kann der Leser die Episode zu Beginn, die erste Kindheitserinnerung, besser einordnen. Sie besteht darin, dass Lothar eine Demonstration von Tschechen in seiner Geburtsstadt Brünn rekapituliert, die für eine Sezession von Österreich-Ungarn eintreten. Jetzt ist es eingetreten: Seine Heimat besteht nur mehr als ein Torso. Er empfindet es nichts weniger als eine Verstümmelung seines Lebens.
Als »sein« Land zusammenbricht, ist man im Buch auf Seite 30; noch weitere 330 Seiten folgen. Und wer diese Art von »hysterischer Liebe«, welche »die Grenzen des normalen Patriotismus« streift (so Daniel Kehlmann im Nachwort) voreilig als Nationalismus oder gar Chauvinismus abtut, wird mit der weiteren Lektüre Schwierigkeiten haben. Lothars Idealisierung der k.u.k.-Monarchie ist nicht primär politisch zu verstehen. Er macht sich keine Mühe, die politischen Implikationen Österreich-Ungarns, die Strukturen der Minderheiten in dem Staatsgebilde oder gar die Ursachen des Krieges zu analysieren. Stattdessen sucht er nach dem Krieg Sigmund Freud auf, um sich erklären zu lassen, wie er den Verlust seiner Heimat überwinden könne. Die Antwort Freuds in der Beschreibung dieses Gesprächs ist einer der Höhepunkte des Buches.