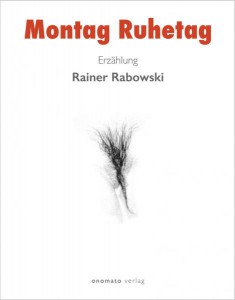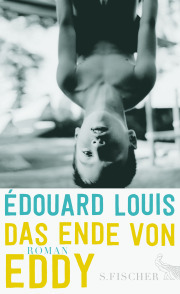Princeton 66
Wieder so ein Jahrestag: Im April 2016 ist es 50 Jahre her, dass die Gruppe 47 in Princeton zusammentraf. Die Tagung gilt gemeinhin als der Anfang vom Ende der Gruppe, nicht zuletzt durch Peter Handkes Statement von der »Beschreibungsimpotenz«, die er bei Autoren wie Kritik gleichermaßen konstatierte. Ein Wutausbruch mit wuchtigen Vokabeln, ein Aufbäumen gegen das sich eingerichtete Literaturestablishment und deren Ästhetik. Aber was kann man grundlegend Neues von diesem Treffen erfahren? Ist nicht schon alles geschrieben und gesagt?
Ja. Und Nein. Jörg Magenau gelingt mit seinem Buch »Princeton 66« das Kunststück, aus leidlich bekannten Quellen eine packende und konzise Zeitreise zu komponieren, die sowohl die Stimmung der Tagung präzise rekonstruiert, als auch historische Einordnungen vornimmt. Dabei geht er chronologisch vor, auch wenn es gelegentliche zeitgeschichtliche Einschübe gibt, die, wie sich zeigt, notwendig sind.
Praktisch von der ersten Seite an wird der Leser hineingesaugt. Man spürt die Lust und die Akribie des Autors sich durch die Aufzeichnungen der insgesamt 31 Lesungen (nebst Diskussionen), die allesamt auf der Webseite der Princeton-Universität im Original gespeichert sind, durchgehört zu haben. So erscheinen einige dieser 50 Jahre alten Texte plötzlich in erstaunlicher Frische. Magenau erzählt beispielsweise über das (eher steife) Drama von Walter Jens, betont die Brisanz des erotisch-deftigen Grass-Gedichts und begeistert sich für die Militär-Satire »Feinde« von Reinhard Lettau, die die gesamte Struktur des militärischen Denkens für immer ad absurdum führe. Man scheint förmlich die Erzählung des grundsympathischen Peter Bichsel, das mühsame Lesen von Helga M. Novak oder Handkes Hauptsatzaneinanderreihung zu hören. Ähnliches mit den Reaktionen der Kritik: Der gut geölte Joachim Kaiser; Walter Jens, dem Wortzerteiler aus Tübingen, der nach seinem Vortrag ganz schnell wieder die Rolle des Kritikers übernahm. Hans Mayers geschliffene Formulierungen. Dann Marcel Reich-Ranicki, ein Grobmotoriker des Urteilens, stets für Heiterkeit und gute Laune sorgend, nicht zuletzt weil er allen Rednern recht gab, um allen zu widersprechen. Und der junge Hellmuth Karasek, der sich Mühe gab, immer ein wenig klüger zu wirken als er war – wogegen nichts zu sagen wäre, denn das trifft ja auf alle zu, bei ihm merkte man es aber.