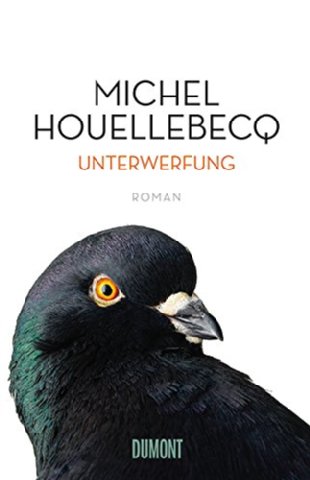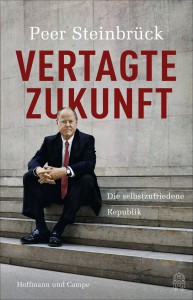
Peer Steinbrück hat ein neues Buch geschrieben. Wie pervers dieser Betrieb ist, kann man daran ablesen, dass er erwähnen muss, dass er es selber geschrieben hat. Seine Titelthese ist einfach: Der Wahlerfolg der Unions-Parteien 2013 (41,5%) geht darauf zurück, dass die Wähler das Bedürfnis nach Ruhe und vor allem politischer Kontinuität gewünscht hätten. Steinbrück bestätigt damit weitgehend die Aussage der Auguren, die Merkels Wahlkampfstrategie mit der von Konrad Adenauer 1957 verglichen hatten, der mit seinem Konterfei und »Keine Experimente« die absolute Mehrheit gewonnen hatte. Die Unionsparteien hätten diese Beschwichtigungsstrategie nicht zuletzt mit Hilfe der Medien erfolgreich umgesetzt. Jede Kritik an den Verhältnissen sei als Miesepeterei angesehen worden. Die Tendenz ging und geht, so Steinbrück, zur »konfliktscheuen Politik«.
Deutlich wird er, wenn es darum geht, dass die SPD sich fragen lassen müsse, warum sie die Wähler nicht habe mobilisieren und aufrütteln können. Die SPD unterschätzte das »Selbstbildnis der Republik«, so Steinbrück. Der Wunsch nach Kontinuität resultierte nicht zuletzt aus den reinen ökonomischen Zahlen. Sie sprachen für die amtierende Kanzlerin. Steinbrück sah sich zudem in der Falle, da er seinem Naturell entsprechend einige politische Entscheidungen von schwarz-gelb nicht kritisieren konnte, weil er ihnen eigentlich selber zustimmte. Dazu zählte der Abbau der Staatsneuverschuldung (»Schwarze Null«) genauso wie die diversen Rettungsschirme für notleidende Euro-Länder. Eine Gegenposition hierzu kam für Steinbrück und die SPD in beiden Fällen nicht infrage.
Perfekt hätten es die Unionsparteien verstanden, die Wähler für ihr »Notariat über die bürgerlich-konservative Interessenwahrung« zu mobilisieren. Der Spagat für die Opposition bestand darin, dass man das Land nicht schlechter reden wollte, als es in großen Teilen der Bevölkerung empfunden wurde. Die Parole nicht alles anders, aber einiges besser machen zu wollen, war bereits vergeben. Steinbrück suchte sich Themen. Diese zündeten jedoch nicht, was er uneingeschränkt eingestand.