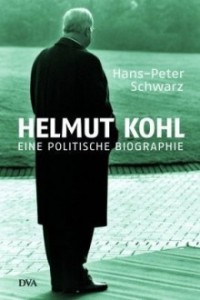Gelegentlich hilft es ja, sich dem Medienstream auszusetzen. So wurde ich auf eine Diskussion aufmerksam, in der es wieder einmal um die Ukraine, Russland und den Westen ging. Der Zuschnitt der Sendung war auf Krawall gebürstet, der auch schon früh eintrat. Der bisher nicht durch politische Analysen besonders hervorgetretene Börsenhändler Dirk Müller wurde als »Putinversteher« angekündigt und auch flugs von Eric Frey vom österreichischen »Standard« als solcher deklariert. Dieses Etikett ist nicht neu; es dient allen Denkfaulen dazu, lästige Ansichten mit einem Federstrich zu diskreditieren. Die Geschwindigkeit, mit der dieses Attribut aus dem rhetorischen Waffenarsenal gezogen wird, ist enorm. Es erinnert von Ferne an die Einwände der Rechtskonservativen und Vertriebenen in den 1970er Jahren, die mit ähnlichen Parolen die Politik des Ausgleichs der sozialliberalen Regierung mit den Ländern Osteuropas diffamierten. »Vaterlandsverräter« war noch das mildeste Attribut. Lediglich auf die Formulierung »Breschnew-Versteher« ist damals niemals gekommen, was gewisse Rückschlüsse auf das heutige Erregungsprekariat der sozialen Medien zulässt.
In der o. e. Diskussion spielte ein Buch eine Rolle, dessen Kenntnis offensichtlich allen Teilnehmern nicht gleichermaßen geläufig war. Es heißt im deutschen Titel »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft« und ist von Zbigniew Brzezinski verfasst, dem Sicherheitsberater einiger (demokratisch dominierter) US-Regierungen (ob offiziell oder inoffiziell). Das Buch ist von 1997 und gilt offenbar als Geheimtipp. Bei Amazon ist das günstigste Angebot aktuell bei rund 190 Euro; für ein Taschenbuch ein stolzer Preis. Die Links auf die kostenlose Zurverfügungstellung setze ich jetzt nicht um mich nicht strafbar zu machen – aber mit ein bisschen Suchen kann sich jeder eine wenn auch schlecht formatierte Version als pdf herunterladen (ein findiger Kopf verkaufte für kurze Zeit den pdf-Ausdruck bei Amazon für 30 Euro).
Um es vorweg zu sagen: Diese Lektüre lohnt trotz des Zeitabstands. Man muss Zbigniew Brzezinskis Thesen in diesem Buch nicht teilen. Für Brzezinski ist Politik ein Schachspiel (der englische Titel ist entsprechend: »The Grand Chessboard«), in dem es vor allem darum geht, strategische Vorteile für die USA zu erringen um Machtansprüche zu erhalten oder auszubauen. Ins Zentrum seiner Betrachtungen steht »Eurasien« – der Raum von Lissabon bis Wladiwostok.