
John Banvilles »Die See« ist bei aller Melancholie und gelegentlichem Sentiment kein Bericht eines selbstmitleidigen Helden, der in den »besten Jahren« die obligatorische Sinnkrise bekommt.

John Banvilles »Die See« ist bei aller Melancholie und gelegentlichem Sentiment kein Bericht eines selbstmitleidigen Helden, der in den »besten Jahren« die obligatorische Sinnkrise bekommt.

Péter Nádas’ hochgelobtes, kleines Büchlein »Behutsame Ortsbestimmung« enthält zwei kleine Geschichten. Die erste, die dem Buch den Titel gab, erzählt (?) von einem kleinen Dorf im ländlichen Ungarn, in das sich der bekannte Schriftsteller gemeinhin begibt; dort (überwiegend?) lebt. Nádas, der »Aussteiger« genannt werden kann (hierin vielen anderen Schriftstellern wie etwa John Berger oder Andrzej Stasiuk ähnlich), versucht hier eine Erzählung über »seinen« Ort, »sein« Dorf und dessen Strukturen und »funktionieren«. Man ist jedoch früh geneigt, hinter dem Begriff des Erzählens eine Fragezeichen zu setzen – denn so richtig ist es dann doch keine Erzählung (Nádas nennt beide dann auch treffend »Zwei Berichte«). Allzu oft gibt es essayistische Züge und wer eine bukolische, emphatische Hymne auf das »natürliche Leben«, auf den (von Nádas anderweitig so hervorgehobenen) Waldbirnenbaum erwartet, wird enttäuscht werden; insofern ist der Untertitel »Die eingehende Betrachtung eines einsamen Waldbirnenbaums« ein bisschen irreführend.
Ausgehend von diesem Ort phantasiert sich Nádas durch die Jahrhunderte und die Geschichte, die von der frühen Besiedlung bis heute rekapitulierbar ist (die römischen Tonscherben sind fast allgegenwärtig) und berichtet dabei (ja: berichtet!) über dieses Dorf und sein Sozialwesen. Alles dichterisch und ohne Pose; erst recht ohne Herablassung (oder – was fast noch schlimmer wäre – stiller oder gar offener Bewunderung).

Eine Ohrfeige für die Jury, die ihren eigenen Kriterien misstraute und einen Beitrag mit kleinlicher Attitüde niedermachte, der ihnen vermutlich auch nicht politisch korrekt genug erschien und statt eines Klageliedes ob einer Kindheit in Jugoslawien (als es noch ein Jugoslawien war) eine lebensfrohe Kindheitsbeschwörung las (»gezwungen« war, zu lesen), in der der junge Aleksandar zwar von den Schrecklichkeiten des Krieges erzählte (in etwa im Ton eines 12–14 jährigen – hier hatte man dann auch literaturkritisch den Hebel angesetzt), aber nicht im gängigen Betroffenheitsjargon des heutig Wissenden, sondern in einer farbenfrohen, heiteren, gelegentlich albernen, dann aber durchaus auch tiefgründigen Art (da weiss der Erzähler dann doch etwas mehr als der junge Aleksandar: warum auch nicht, denn Literatur ist keine Dokumentation).
Günter Grass hat die Diskussion um seine SS-Zugehörigkeit vermutlich mehr getroffen, als anfangs angenommen. Er hat jedenfalls eine Unterlassungsklage gegen die FAZ erwirkt, die Briefe von ihm an Karl Schiller in Gänze veröffentlicht hatte. Grass sah das Urheberrecht bei sich. Ich bin kein Jurist, aber es gibt hier Zweifel. Die einstweilige Verfügung, die er erwirkt hat, sagt ja nichts über ein eventuelles Urteil aus.

Arno Geigers hymnisch gepriesenes Familienepos (?) »Es geht uns gut« wurde 2005 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Könnte man aufgrund der Qualität dieses Buches auf die Qualität der im Wettbewerb um den Buchpreis gescheiterten Kandidaten rückschliessen – so bliebe einem eine Menge potentieller Lektüre erspart. Wenn ein solches Buch tatsächlich das beste gewesen sein soll, kann es um die anderen nicht gut stehen. Aber gemach – die Vehemenz der Kritik mutet böser an, als gedacht.
Geiger zeichnet das Portrait einer österreichischen Familie, beginnend in den 30er Jahren bis 2001.
Wenn man historische Begebenheiten literarisch bearbeitet, so gibt es mehrere Fallstricke, in die sich der Autor verfangen kann: Er kann mit seiner These der Ereignisse in einen Furor der Unbelehrbarkeit verfallen – die Geburt der Verschwörungstheorie. Er kann in Einseitigkeit versinken und den notwendigen Abstand vergessen – blinde Parteinahme. Der schlimmste Fall ist aber das Verschwimmen von Fiktion und Dokumentarischem. Indem reale Ereignisse, die mindestens ausschnittweise in einer bestimmten Zeit öffentlich gemacht wurden, als Grundlage literarischer Bearbeitung dienen, ist dem Leser ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr klar, wann die Freiheit des Dichterdenkens beginnt und die Fakten zu diesen Gunsten aufgegeben werden.

Bereits auf den ersten Seiten wird klar: Christoph Hein be-(oder ver-?)arbeitet den Tod des mutmasslichen Terroristen Wolfgang Grams vom Juni 1993 auf dem Bahnhof von Bad Kleinen. Der Ort wird namentlich nicht verfremdet – die Protagonisten sehr wohl. Wolfgang Grams heisst Oliver Zurek; die Hauptprotagonisten dieses Kammerspiels, die Eltern, Richard und Friederike.

Am Anfang des Buches sitzt der österreichische Literaturprofessor Stein, der in den USA lebt und arbeitet, im Flugzeug. Für ihn, dem heimatlosen Weltbürger, sind dies fast die schönsten Stunden; Horte der Ruhe; Zeiten, in dem von ihm keine Handlungen, keine Entscheidungen abverlangt werden. Stein sieht eine politische Talkshow im Flugzeugfernsehen. Er nimmt nicht sofort den Kopfhörer, sondern schaut nur dem Fernsehbild zu.
Dann wurde ihm plötzlich die Lächerlichkeit dieser Fernsehrunde bewusst. Wie wenig die hier zum Gespräch geladenen Herrschaften zu überzeugen vermochten, solange der Ton ausgeschaltet blieb! Allein am Gehörtwerden hing ihre Existenz; wie sie da mit den Händen grosse Gesten in den Raum schrieben und mit ihren durchwegs müden – denn begeistert war da keiner mehr – Gesichtern ein wenig Leidenschaft für ihr Thema vorzutäuschen versuchten, ergab ein trauriges Bild...Das »Weltgeschehen« bestand darin, dass darüber geredet wurde.
Stein, 48 Jahre alt, verheiratet, hat zwei fast erwachsene Töchter (15 und 19), einen nicht besonders anstrengenden, aber gut dotierten Beruf, der ihm allerdings keine Befriedigung verschafft, weil ihm die Anerkennung versagt bleibt (was wohl daran liegt, dass er irgendwann schlichtweg das Interesse an der Literatur verloren hat [interessante Innenansicht eines zum Nichtleser gewordenen]). Seine Flüge nach Europa dienen meist nur oberflächlich seinem Beruf; er besucht seinen Freund Stéphane in Paris, ein sehr erfolgreicher und bekannter Anwalt – in vielem das Gegenstück zu Stein. Und er besucht seine Geliebten. Stéphane, der dem Beruf verhaftete Mensch, extrovertiert, mit wechselnden Frauenaffären, in den Tag hineinlebend – Stein der Grübler, introvertiert; aber ebenfalls mit wechselnden Gebliebten.
Der auktoriale Erzähler, eher Stein zugewandt, weiss viel zum Verhältnis der beiden zu erzählen – bis zur Frage, was sie denn tatsächlich als Freunde verbindet oder ob es nicht nur eine Art Bindung ist, die keiner von beiden bisher beendet hat (aus Bequemlichkeit oder Gewohnheit). Freilich sind die Bande der Deserteure des Lebens nicht mit den gängigen Mustern einer normalen »Freundschaft« zu charakterisieren. Obwohl Stein sich dann fast selbst entrüstet zusieht, als er Stéphane zu dessen 50. Geburtstag einen Flug in die Staaten schenkt. Sehnsüchtig erwartet Stein, dass der Fluggutschein verfallen möge – kurz vorher jedoch kündigt der quirlige Freund sein Ankommen jedoch an.
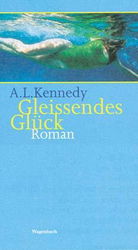
A. L. Kennedy zeigt uns etwas, was wir seit unserer Kindheit kennen, etwas was wir nur bei anderen sehen, nie bei uns: das Klischee. So gut, so schön. Eine Vortragsreise des Lebenshelfers nach Deutschland nutzt sie, ihn zu begleiten. Ihr Brief hat ihn beeindruckt, man trifft sich; der Professor ist auch so, wie man sich im allgemeinen solche Leute vorstellt: arrogant, herablassend, keine Zeit.
Man weiss damit nach ungefähr 30 Seiten, was passiert. Der Professor entpuppt sich als gar nicht so toll, wie er scheint; der Mann prügelt seine Frau als er erfährt, wo sie wirklich war, sie flüchtet zu Gluck, eine zarte Liebesbande beginnt (der Professor muss seinem Laster, unabänderlich Pornos sich ansehen zu müssen, entsagen und rasiert stattdessen der Frau die Schamhaare), usw. usw.
Unfassbar ist nicht die Geschichte, die die Schottin hier erzählt. Unfassbar ist, wie ein Sammelsurium von Klischees, Holzschnitten und Plattitüden derart enthusiastisch von der Literaturkritik besprochen werden konnte. Das Buch ist ohne Sprache, durchschaubar, fast fad. Die Sprödheit, Lakonie, die eine erzählerische Grundhaltung ausdrücken soll, ist so zäh wie altes Brot, was zu lange an der Luft gelegen hat. Das Ende, die fast pubertär anmutende geschlechtliche Vereinigung zwischen der durch glückliche Umstände (Selbsttötung) zur Witwe gewordenen Frau und dem „bekehrten“ Glückspropheten schwülstig. Hätte man im 19. Jahrhundert einen Geschlechtsverkehr „beschreiben“ können, es hätte so geschehen können.