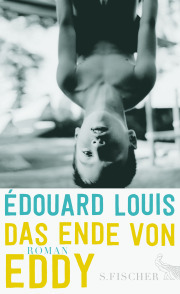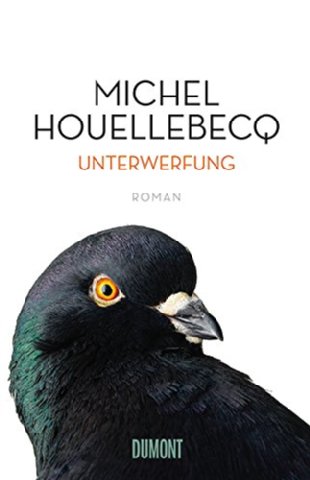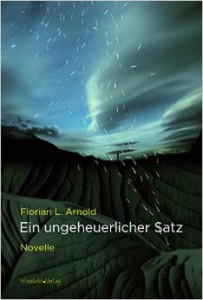
Ein ungeheuerlicher Satz
»Novelle« nennt Florian L. Arnold sein Buch »Ein ungeheuerlicher Satz«. Seit einigen Jahren bedienen sich Verlage dieser Gattungsbezeichnung vermehrt, um kurze Erzählungen, die nicht als Roman vermarktet werden können, aufzuwerten. »Novelle« dient dabei Fall als Distinktionsmerkmal gegenüber »Erzählung«. Hier trifft diese Spielerei jedoch nicht zu. Es handelt sich tatsächlich um eine »unerhörte Begebenheit«, wie Goethes Definition der Novelle lautete. Der namenlose Ich-Erzähler, ein 13jähriger Junge (?), wird eines Tages mit einem »ungeheuerlichen Satz« seines Vaters konfrontiert: »Wir gehen weg«. Die Folgen werden einschneidend sein.
Man lebt in einer Art Wildnis; für sich, alleine. Die Zeit, in der die Novelle spielt, ist nicht eruierbar. Zwei‑, dreimal im Jahr fährt die Familie mit einem alten, »selbstmordgefährdeten« Auto in die Stadt. Dort kauft man unter anderem schwarze, unlinierte Hefte, die vom Vater irgendwann zwanghaft vollgeschrieben und von der Mutter dann per Post nach »Ignatu« verschickt werden. Ansonsten lebt man vom Gemüsegarten. Es scheint weder Telefon noch Internet zu geben. Soziale Kontakte halten sich in Grenzen, bleiben schließlich bis auf einen gewissen Rösenmarrer gänzlich aus (und sofort denkt man bei diesem Namen an Roithamer aus Thomas Bernhards »Korrektur«).
Der Vater, eine Hermann-Burger-Figur, ist ein rauchender Melancholiker, geheimnisvoll in seinem scheinbar kindischen Hass auf das Licht, die Sonne, die Hitze, den Sommer. Ein Mann, der mit seinem Sohn über einen längst verwilderten Friedhof spaziert und Grabsteine buchstabiert, entziffert und sich von seinem Kind die Lebensdaten ausrechnen lässt.