Über den Dichter-Erzähler Xaver Bayer
Treffpunkt: eine Art Unort. Ein Café, eingerichtet eher wie ein Wirtshaus, an einem samstags ungeheuer belebten Markt an der städtischen Peripherie von Wien. Im halbdunklen Raum des Cafés während der zwei Stunden kaum Gäste: andere Welt, in der sich gut reden – und schreiben läßt, denn Xaver Bayers Bücher entstehen handschriftlich an Orten wie diesem. Wohnen tut er im Zentrum, in einer von der Großmutter übernommenen Wohnung mit einem Mietzins, der so niedrig ist, daß ihn die Besitzer hassen, weil er immer noch nicht ausgezogen ist. Mit diesem Gedanken spielt er, weil er die hyperkommerzialisierte Innenstadt zunehmend unerträglich findet. Aber der Mietzins ist heute auch an der Peripherie zu hoch. Eine luxuriöse und zugleich bescheidene Existenz führt der Dichter, nicht asketisch, aber am Minimum entlang. Das Wort »Luxus« gebraucht Bayer öfters, immer mit entschuldigender Geste. Und als Dichter erscheint er mir, seit ich ihn kenne, obwohl er in erster Linie ein Erzähler ist. Morgens nach dem Aufstehen, erzählt er, liest er eine ganze Weile Gedichte. So beginnt in der Regel sein Tag.

Das Wort »Vanitas« habe ich ins Gespräch geworfen, weil in Geheimnisvolles Knistern mehrmals von Vergeblichkeit die Rede ist. Vergebliches Tun: Definition von Sisyphusarbeit, aber im Sinn des fröhlichen Sisyphus, wie ihn Albert Camus propagierte. Fröhlich und melancholisch zugleich, nicht mit der hochgespannten Dramatik des Barocks, zu dem Bayer dennoch eine gewisse Affinität hat. Von Verschlungenem verschlungen... Auf Doppelbödigkeit und Manierismus verweist auch das italienische Motto des Buchs, das aus dem Park der Ungeheuer von Bomarzo stammt, einer Art Freilichtmuseum des Grotesken, im 16. Jahrhundert für den Adeligen Vicino Orsini errichtet. Der Besucher des Parks (und wohl auch der Leser von Bayers Buch) soll sich fragen, ob all die grotesken, unheimlichen oder komischen, Wunderwerke durch Täuschung oder durch Kunst hervorgebracht sind. Und weiters, so läßt sich die Aufforderung fortspinnen, ob jene Kunst, die mit Sinnestäuschungen, mit Verzerrungen arbeitet, nicht an Wahrheiten rührt, die auf geradem Weg nicht ohne weiteres zugänglich sind. Auf Bayers Zauberreich angewandt ließe sich fragen, ob die manchmal tatsächlich monströsen Sprachbilder Ausgeburten einer verschrobenen Phantasie sind oder doch eher Beschreibungen von Wirklichkeit, die der Normalbürger in seinem Alltag – der Spießer: auch dieses Wort aus dem Munde des Autors – lieber nicht sehen will.
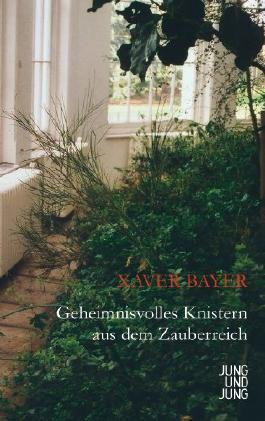
Geheimnisvolles Knistern aus dem Zauberreich
Der letzte Satz dieses Buchs ist zugleich sein erster; der Schreiber führt den Leser virtuell in die Endlosschleife der Variationen des Gleichen: »Und die Geschichte ist diese.« Xavier de Maistre beschwor Ende des 18. Jahrhunderts die Offenheit seiner Seele für alle Gedanken und Empfindungen; es gebe kein größeres Vergnügen, als die Spur der eigenen Gedanken zu verfolgen, »wie der Jäger seine Beute verfolgt, ohne sich dabei an irgendeinen vorgegebenen Weg zu halten.« Er betont, auf der Reise in seinem Zimmer selten eine gerade Linie zu verfolgen, aber der wahre Zick-Zack-Kurs vollzieht sich nicht im Zimmer, sondern in seinem Kopf. Und so ist das auch bei Xaver Bayer, oder eigentlich in viel stärkerem Maß, noch zick-zackiger, denn die Erzählstruktur der Reise von de Maistre, in kleine Kapitelchen gegliedert, ist eher konventionell, der Stil rhetorisch, die Entdeckung des inneren Kontinents als Reisegebiet ein Vorwand, um sich ein wenig dem Essayismus zu widmen, der es dem Schreibenden erlaubt, umherzuschweifen statt alle seine Gedanken auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Xaver Bayer, zweihundert Jahre später, ist doch viel radikaler; er macht mit dem Vorsatz ernst, alles, was im Bewußtsein auftaucht, schriftlich zu fixieren und die merkwürdigen Bahnen, auf denen es sich bewegt, nachzuzeichnen.
Diese Bahnen wirken chaotisch, sie sind chaotisch und werden immer wieder geordnet, zusammengeführt, gebündelt, um dann doch wieder auseinanderzudriften, ein ewiger Kampf oder Tanz zwischen zentrifugalen und zentripetalen Kräften. Eine der spontanen Ordnungsgesten ist das Zusammenstellen von Ähnlichem, die Anwendung des Kriteriums der Ähnlichkeit als Grundlage jeglicher Klassifizierung – so daß die Chronologie und damit das Erzählen immer wieder unterbrochen und insgesamt verlangsamt, ja, tendenziell zum Stillstand gebracht wird. Ähnliche Dinge, ähnliche Erlebnisse: der Autor versieht auf seinem Beutezug die Bahnen der Erzählung mit Vertikalen, er macht Fransen hinein und arbeitet an einem Fraktal: die Erzählung als Ganze ist oder besser: sie wird ein Fraktal, das sich auf unvorhersehbare Weise immer weiter untergliedert, ausfransend und einfransend, je nach dem Standort, von dem man es sieht. Bayers Ehrgeiz ging nicht nur dahin, mit einem einzigen Satz ein Buch zu machen, vielmehr versucht er wie schon in den Erzählungen Liebe und Künstlerische Freiheit in seinem Band Die durchsichtigen Hände, innere Abläufe mit größtmöglicher Präzision und Vollständigkeit sprachlich wiederzugeben. Das ist durchaus spannend, nicht nur wegen der Inhalte (zahllose Bilder, Episoden und Ideen) und Formen (der chaosmotische Tanz der Sätze), sondern vor allem wegen der sozusagen »unmöglichen« Aufgabenstellung. Bei der Verwirklichung dieses Vorhabens ist Bayer James Joyce näher gekommen als Xavier de Maistre; abzüglich der wortwitzigen Faxen des irischen Meisters, dafür mit umsomehr sprachlicher Wendigkeit und einer lockeren Prosodie, die ihm leicht fällt, weil er nicht nach Bedeutungsfülle hascht und kein abstraktes Erzählkorsett anlegt, sondern Bedeutungen jeweils dort entgegennimmt, wo sie der Gedankenstrom anspült. Assoziationsketten, selbstläufig und dennoch kontrolliert. Sich als Autor der Sprache, dem Denken, der Erzählung überlassen und dabei dennoch als Subjekt souverän bleiben: Bayer schafft es scheinbar mühelos, und wir können getrost vermuten, daß dahinter einige Arbeit steckt.
Wie bin ich eigentlich auf Xavier de Maistre gekommen? Bayer selbst hat mich auf ihn aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang... Ohne Zusammenhang, Flucht der Gedanken, Wirrwarr der Gespräche. Wir standen unter dem Dach einer Hütte im Park vor dem Schloß von Nagoya, da es plötzlich zu regnen begonnen hatte, und Bayer versuchte, dort eine Zigarette zu rauchen, was inzwischen fast überall auf der Welt verboten ist, so daß ihn alsbald eine Parkwärterin aufmerksam machte, und ich wollte ihm beispringen, rauchen Sie doch da hinter der Ecke, stört doch keinen, aber Bayer machte seelenruhig die Zigarette aus: dieses Zurückstecken, das Gefühl des Ertapptseins (beim Leben ertappt?), dessen sich die Bayerschen Helden öfters bezichtigen, alle diese kleinen Resignationen erschienen mir als Stärke, als Voraussetzung jener panoramischen Offenheit, von welcher der Zimmerreisende Xavier de Maistre spricht. So viele Irrtümer, so viele Halbheiten, so viel Weder-Noch, woraus die Welt gemacht ist; und auch der Mut, sich der Welt zu stellen, sie zu nehmen, wie sie ist. Ich erwähnte Kremsmünster (keine Ahnung, warum), da war ich zur Schule gegangen, und Bayer kam auf einen Prosatext von Händl Klaus zu sprechen, einen Text mit Forellen, aber der bezieht sich gar nicht auf Kremsmünster, die Forellen tummeln sich nicht im Fischbehälter des Johann Bernhard Fischer von Erlach, sondern in Paulsberg, einem vermutlich fiktiven Ort, und ich dachte an Joseph de Maistre und mir fiel erst später ein, daß Joseph und Xavier tatsächlich Brüder waren, und als ich die Mémoires d’Outre-Tombe erwähnte, spürte ich schon, daß sie gar nicht von Joseph de Maistre sind, sondern von Chateaubriand (vor fünfundzwanzig Jahren hatte ich in meiner Pariser Mansardenwohnung oft darin gelesen). So beruhten und beruht unsere Unterhaltung auf Irrtümern, die sich mit Wahrheiten mischen, auf Erinnerungen und Einbildungen, Verzerrungen und Wiederholungen, und ich frage mich, ja, ich stelle mir gerade vor, wie ein immer noch junger Mann, Xaver Bayer, in sein Buch hineinspaziert und darin ein anderer wird und als ein anderer herauskommt, um dann doch jedesmal wieder von vorne anzufangen und der zu bleiben, der er ist. Die Reisen, die Xavier de Maistre im 37. Kapitel seines Reisebuchs beschreibt, finden in Büchern statt. Was sonst soll man in seinem Zimmer tun, wenn nicht lesen? Und schlafen, dösen, Gedanken nachhängen, seinen Diener schelten, Frust abladen...
Geheimnisvolles Knistern aus dem Zauberreich ist ein Gegenstück zu Wenn die Kinder Steine werfen – fast so, als hätte der Autor uns (und sich) beweisen wollen, daß er auch ganz anders kann. Keine Wendung um 180 Grad, nein; mit Zahlen lassen sich schöpferische Richtungswechsel nicht beschreiben. Das neue Buch besteht aus vielen kurzen Prosastücken, von denen einige wiederum aus Kurzsätzen komponiert sind. Um die Machart des Werks zu erläutern, zieht Bayer einen Vergleich zum Free Jazz. Nicht im Sinn eines Programms, das er erfüllt habe, sondern als Parallele, die ihm irgendwann aufgegangen ist. Einen Ton finden, einen Funken zünden, den man eine Weile wachhält und zum Brennen bringt, bevor er verlöscht. So etwa gestalten sich diese Prosastücke, bald mit größerer, dann wieder mit verhaltener Intensität. Träume, ja, Verformungen und Verzerrungen, Höhenflüge und kleine Kunststücke, der freie Lauf der Phantasie – aber auch Sorge um die Darstellbarkeit einer Wirklichkeit, die unwirklich, virtuell, hybrid, surrealistisch geworden ist. Altmodisch innovativ wirkt dieses Verfahren und Gebaren, getragen auch von der Vermutung, daß in irgendeiner, vielleicht nicht allzu fernen Zukunft die technischen Regulierungen, die unser Leben bestimmen, hinterfragt und ausgesetzt werden, weil sie ausgesetzt werden müssen, genauso wie die Rücksichtslosigkeit gegen die Umwelt – darauf weist Bayer hin – revidiert werden mußte, nicht zuletzt auch, damit die Ökonomie, von der die Rücksichslosigkeit ausging, überleben kann. Freilich befürchtet er auch, daß die Digitalisierung die Köpfe in einem Maß beherrschen und transformieren wird, daß an ein Zurückrudern dann nicht mehr zu denken sein wird.
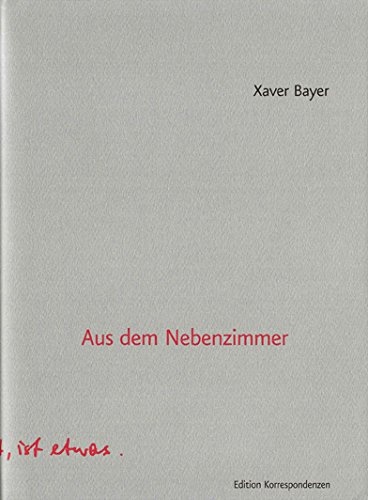
Ich scheue mich und korrigiere: ein kleiner Autor von eher schmalen Büchern. Keine großen Romankonstruktionen, keine Gesellschaftspanoramen, nur ein paar Freunde und Freundinnen zur Hauptfigur, die oft ein Ich-Erzähler oder Alter-Ego des Autors ist. Vorherrschend Innerlichkeit, Innenwelten, die Außenwelten spiegeln und verformen, Außenwelten, die Innenwelten usw., Neugier und Abscheu des Ichs, zuweilen Ekel, nausée. Geht morgens aus dem Haus, oder auch nicht, klebt am Schreibtisch, verläßt seine Single-Wohnung, streunt umher, hat nichts Besonderes zu tun. Wischspuren von Träumen, Befragungen, Sehnsüchten, Verwerfungen an der Außenwelt. Wandelndes Sichtglas, wodurch das zu Sehende bald verschleiert, bald im Schlaglicht erscheint. Viele kleine erhellende Momente. Geheimnisvolles Knistern, dem der Held lauscht und nachforscht, nachsinnt.
»Man braucht oder zumindest ich brauche dreierlei, um schreiben zu können: Ich bin auf ein Gefühl angewiesen, muss eine passende Form dafür finden und benötige Ausdauer zur Ausführung«, sagt Bayer in seiner Art von Rede. Als Wortkunstwerk hat das Buch das Verlangen, jenes Gefühl zu bewahren und zu vermitteln. Wem? Den anderen, sicher eine verschwindende Minderheit, die für solche Gefühle – selten die großen, nie die klischeehaften; oft wilde, also scheue; auch domestizierte Gefühle – empfänglich sind. Aufmerksamkeit und Empfänglichkeit sind die Grundvoraussetzungen nicht nur für das Schreiben, sondern für das Lesen von Literatur, die den Namen Kunst verdient. Auch Ausdauer, für beide. Ohne Scheu vor dem Schwierigen... Denn Bayer kann auch schwierig sein, oft ist er leicht und schwierig, schwierig und leicht. Liest man einen Roman, eine Erzählung von Xaver Bayer, bleibt im Gedächtnis eher ein Gefühl, eine Atmosphäre, eine Reihe von Farbschattierungen zurück. Eher als das, was Sache war.
Einmal geht der Held auf eine Demonstration gegen die neue Regierung, die in der historischen Wirklichkeit zweifellos die im Februar 2000 angelobte sogenannte schwarz-blaue Koalitionsregierung ist. Er tut es ohne große Lust, wahrscheinlich nur, weil er sich mit einer Freundin verabredet hat, aber nicht in erster Linie, um diese Regierung durch seine Stimme, seine Anwesenheit zu bekämpfen. Irgendwann gerät er, mehr oder minder zufällig, sogar an die Spitze des Demonstrationszugs. Aus einer Laune heraus führt er die Menge in ein Hotel und dann in ein Theater (vermutlich das Burgtheater). Später wendet er sich von all den Empörten wieder ab. Die Aktion ist eher ein Scherz als eine zielbewusste Handlung. Derlei Scherze, von Bayer oft melancholisch vorgetragen, kommen in seinen Büchern nicht selten vor. Die von ihm geschilderte oder geschaffene Atmosphäre unterscheidet sich von der bedrückenden, in manchen Momenten aber auch hoffnungsgeladenen Stimmung in Thomas Stangls Roman Die Regeln des Tanzes, dessen Hauptfigur sich viel auf den in Wien damals wöchentlich stattfindenden Demonstrationen herumtreibt, vielleicht tatsächlich auf der Suche nach einem nicht mehr für möglich gehaltenen Sinn. Am Ende von Bayers kurzer Erzählung steht eine Distanzierung von der politischen Haltung der Demonstranten, die durchaus bedenkenswert ist und – aber? – den Aktivismus durch eine, fast möchte man sagen: heroisch-resignative Haltung ersetzt. »Als er wieder nach Hause zurückgekehrt war, schrieb der junge Mann dann, ohne sich dazu auch nur die Jacke aufzuknöpfen oder die Schuhe auszuziehen, auf die Hinterseite eines am Morgen desselben Tags empfangenen Briefs vom Gaswerk, in dem eine neue Gaspreiserhöhung mitgeteilt und bedauert wurde, folgende Sätze: Ihr habt euch im Grunde doch gefreut, als die neue Regierung an die Macht kam, da konntet ihr eure Singlewohnungen und eure Medikamentenpackungen verlassen, euch den roten Schal umlegen, den ihr sonst nur im Fasching oder aus Ironie getragen habt, da konntet ihr endlich auf die Straßen und euch ein bisschen so fühlen wie in einem nachkolorierten Schwarzweißfilm. Unter euresgleichen konntet ihr sein, so dachtet ihr, euer deprimiertes Leben mit einem Inhalt füllen, mit einer Gesinnung, bei der man nichts falsch machen kann.«
Als Schreibender zieht Bayer es vor, die Leere leer sein zu lassen, das Gefühl der Depression zu beschreiben und im übrigen Eingänge ins Zauberreich aufzuspüren, dessen geheimes Fortleben oder Wiedererstehen zu erhaschen und seine Existenz weiterzusagen. Insofern ist der Flaneur des 21. Jahrhunderts, den Bayer als Wiedergänger der Figur des Dandys des 19. Jahrhunderts darstellt, ein Bewohner des Elfenbeinturms, der von seiner Warte aus gesellschaftliche Vorgänge zwar beobachten mag, sich zum politischen Aufklärer aber sicher nicht eignet. Besser, die Leere aushalten, als das Illusionsspiel der großen Inhalte ein weiteres Mal, als Farce der Farce, zu spielen. Die Beliebigkeit, die man Bayers Schreibweise vorhalten kann, ist ein Reflex jener Beliebigkeit, die unsere Epoche, wie es aussieht, nicht ablegen kann. »Hier in diesem Zimmer werde ich fehlen / Hier in diesem Zimmer werde ich nicht fehlen«: das gilt nicht nur für den Bayerschen Helden, es gilt für uns alle.
Am schönsten illustriert scheint mir das Zauberreich in Bayers Langgedichten (manche sind auch kürzer). Ein wesentliches Verdienst der Sammlung von Texten aus dem Nebenzimmer besteht darin, daß es die poetische Grundlage seines genuinen Erzählens bestätigt und sinnfällig macht. Kein Wunder, wo Bayer doch Morgen für Morgen, nach dem Aufstehen und vor dem Schreiben, Gedichte liest, die am Vormittag gewiß weiterwirken. In seinen eigenen Gedichten finden sich trockene, illusionslose, dabei doch irgendwie schöne Beschreibungen Endlosschleife der Konsumwelt, deren Glanz längst trüb geworden ist, die Wirklichkeit selbst ein blinder Spiegel, eine taubstumme Musik.
»Ein Spießrutenlauf durch Regalfluchten.
Aus den Lautsprechern hallt Animiermusik.
Das Anstehen an der Kassa und auch
Das Zahlen wie ein groteskes Ritual.
Welcher Tag heute ist, bemerke ich
Erst bei einem Blick auf den Kassazettel.
Die Schiebetür schließt sich hinter mir, und
Ich fühle mich im Freien wie entkommen.«
Aufatmen. Das wollen die Gedichte und auch die Erzählungen. Anleitungen zum Aufatmen sein. »Astrein die Nacht. Käfig ohne Stäbe.« Schmerzhaft klar. Die Nacht? Die Sätze? »Der Gefangene war eigentlich frei, er konnte an allem teilnehmen, nichts entging ihm draußen, selbst verlassen hätte er den Käfig können, die Gitterstangen standen ja meterweit auseinander, nicht einmal gefangen war er.« (Kafka.)
Kafka hat alles vorhergesehen, nicht nur die Konzentrationslager, auch die Kontrollgesellschaft, auch diese Art von Freiheit, die uns zunehmend knechtet. »Aber im ganz Verborgenen seid ihr doch gerührt bei dem Gedanken, dass diese Regierung vielleicht so eine werden könnte wie damals [Haider = Hitler, L. F.], oder auch nur annähernd so schlimm, aber ihr seid euch nur noch nicht so ganz sicher, ob ihr dann die sein wollt, die als romantische Partisanen im Untergrund kämpfen, oder die, die deportiert werden. Ihr selbstmitleidigen Trostlosen! Was soll aus euch nur werden?« (X. Bayer)
Ja, was soll aus uns werden?
Und was wird aus dem erzählenden Dichter in seinem luxuriös bescheidenen, bescheiden luxuriösen Elfenbeinturm? In einer bestimmten Hinsicht ist diese Existenzform gar kein Wollen, sondern Bestimmung, die Bayer schon in der Volksschule empfand, als er entgegen den Regeln vom »guten Stil« die Wortwiederholungen in einem Text Erich Kästners verteidigte. Abweichungen von der gewohnten, gefälligen Norm – da kam für den kleinen Xaver, der schon recht bald Schriftsteller und Flaneur sein würde, kein Kompromiß in Frage, kein Zurückweichen, das mußte so sein. Die Abweichung wurde per se zum Merkmal der Dichterexistenz, das Danebenstehen, die Zeitlosigkeit: fast eine conditio sine qua non. Abweichung als ästhetisches und innovatives Potential. Freilich ohne große Erfolgshoffnung, jedenfalls was die Zeitgenossenschaft betrifft. Der Innenstadtdichter muß (und will) sich an den Rändern umtun. Was aber will er damit? Vielleicht »die Spießer« ärgern. Spießer, altmodisches Wort, noch aus der Zeit vor der Generation Golf. Bayer sammelt das alles, er bewegt sich frei, wägt ab, nimmt oder verwirft, von Bomarzo nach Favoriten, vom Barock in die dunkle Romantik, von der Tradition in die unbekannte Zukunft. Es entsteht... Nun, was? Man kann es, wenn man will, später immer noch definieren. Erst einmal muß es sich gestalten, umgestalten. Ob es entsteht, jedesmal voraussetzungslos neu, diese Sicherheit hat der Dichter-Erzähler nie. Freiheit heißt, sich solcher Sicherheiten begeben.
© Leopold Federmair
Neu von Xaver Bayer:
– Geheimnisvolles Knistern aus dem Zauberreich. Salzburg, Jung und Jung 2014
– Aus dem Nebenzimmer. Wien, Edition Korrespondenzen 2014
