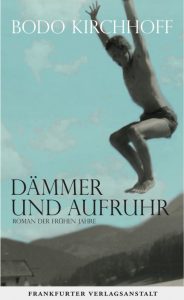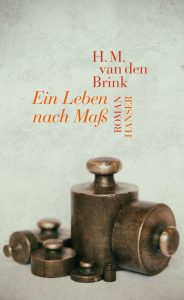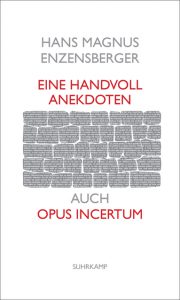
Eine Handvoll Anekdoten – auch Opus incertum
»Eine Handvoll Anekdoten« nennt Hans Magnus Enzensberger sein neuestes Buch und da ist auch schon das erste von so vielen Understatements. Denn es sind insgesamt 107 Geschichten, Fundstücke (der Untertitel: »Opus Incertum«!). Exkursionen in die Vergangenheit einer Kindheit und Jugend. Die Ausflüge werden einhundertzwanzig Mal kongenial bebildert; sehr viel aus dem »FAE«, dem Familienarchiv Enzensberger (nur manches ist überflüssig – einen Schäferhund kennt man schon heutzutage noch). Gelegentlich verlässt Enzensberger die Ereignisse, erzählt vom Schicksal der Personen oder leitet aus dem Geschehen Prägungen für sein weiteres restliche Leben ab.
Die Hauptfigur heißt »M.«, womit natürlich der Verfasser gemeint ist. Oder, etwas genauer: M. ist die Figur, wie sich Enzensberger heute an seine Kindheit und Jugend erinnert. Die dritte Person Singular ist dabei die kleinstmögliche Diskretionsstufe, wenn es um sich und seine Familie geht. »Wenn er über sich selber schreibt,//schreibt er über einen andern.«, so heißt es denn auch in einem vierzeiligen »Envoi« am Ende. Dennoch: Ein So-tun-als-ob gibt es für den 89jährigen nicht. Enzensberger versucht erst gar nicht, die kindliche oder jugendliche Erzählperspektive zu simulieren. Dafür weiß er zu genau wie es (mit und ohne ihn) weiter geht.
Es beginnt chronologisch (in den ersten Jahren noch leicht intermittierend). Vom Geburtsjahr 1929 hat der Erzähler des Erzählers naturgemäß nur wenig in Erinnerung. Irgendwann jedoch eine nicht endend wollende Schlange von gelben Postautos – passend zum »Postassessor« des Vaters, der auch noch als Komparse in Stummfilmen und als Radioansager tätig war. Unterfordert sei er in seiner Tätigkeit gewesen. In seiner Freizeit baute er eine Holzeisenbahn, zeichnete Entwürfe zu Bauwerken und photographierte.
Ja, Mitglied in der Partei war er schon, der Vater. Weil er seinen Status als Beamter nicht verlieren wollte (er stieg auf zum »Telegraphendirektor«). Jahre später lauscht M. einem Gespräch des Vaters mit einem Freund. Eine bessere Position habe man ihm angeboten, in Berlin. Aber das wollte er nicht, dieses Sich-gemein-Machen. Und als der eigentlich ZbV eingestufte 1940 für den Neuaufbau des Pariser Telefonnetzes für einige Monate zum »Etappenhasen« wird, abonniert er nach seiner Rückkehr weiterhin die »Brüsseler Zeitung«, die etwas unabhängiger als der »Völkische Beobachter« berichtet. Am Ende des Krieges sitzt er im Gefängnis wegen »Wehrkraftzersetzung«. Kontakte zum Widerstand werden vermutet. Aber die Ankläger sind schon so klug, die Akten verschwinden zu lassen. Was dazu führt, dass die »Persilscheine« des Vaters den Amerikanern zu glatt vorkommen.