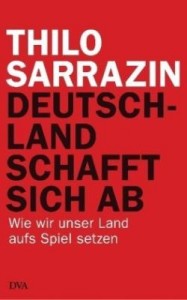Im Unterschied zu Wissen und Information, die als statisch oder festgefügt angesehen werden, assoziiert man „bilden“ und „Bildung“ mit einem Vorgang kontinuierlicher Veränderung. Es ist sinnvoll, von einem derzeitigen Stand des Wissens auszugehen, jedoch nicht von einer aktuellen, zeitgemäßen Form von Bildung, die immer über das bloße Sammeln und Ordnen in einer Art Setzkasten, einer Kartei oder einem Lexikon, hinausgeht, aber ohne den Erwerb von Wissen nicht denkbar ist: Bildung liegt eine bestimmte Art und Weise der Handhabung von Information und Wissen zu Grunde, die sie erst konstituiert. Die Inhalte des Bildungsprozesses, die Art und Relevanz des beteiligten Wissens, können (und sollten) unter dem Aspekt des Verfalls und der Erneuerung betrachtet werden.
Es liegt nahe, Bildungsprozesse als vorläufige, nie abgeschlossene Formung und Gestaltung aufzufassen. Aber was verändert sich eigentlich, worin nimmt es seinen Ausgang und welchen Zielen dient es? In welchen Relationen muss ein Wissenserwerb stehen, um Bildung genannt zu werden? Und was macht das zweite gegenüber dem ersten besonders?