Eine Verdichtung von Indizien, Zuständen und Befindlichkeiten, im Besonderen, aber nicht ausschließlich, der österreichischen, repräsentativen Demokratie, soll exemplarisch die Notwendigkeit ihres Umbaus aufzeigen und seine Richtung knapp skizzieren. Nicht mehr: Das Warum entscheidend, die konkreten Details können zu einem späteren Zeitpunkt folgen — zuerst muss nach Einigkeit gefragt werden*.
Demokratie und Rechtsstaat
Die gemeingefährliche Demokratie
Im Mai 2010 schrieb der österreichische Schriftsteller in einem Essay über seine Hospitation in der Brüsseler EU-Bürokratie über den »Befreiungsschritt, wenn über die Rahmenbedingungen unseres Lebens eben nicht mehr wesentlich durch Volkswahlen abgestimmt wird.« Begründet wird diese »Befreiung« von den Niederungen der Demokratie, weil damit »xenophobe, rassistische, autoritäre Charaktere« keine Berücksichtigung finden würden. Als abschreckendes Beispiel dient u. a. das Europäische Parlament, welches durchaus Mitglieder solcher Parteien beherbergt. Die Idee, xenophobe und rassistische Politikentwürfe mit Sachargumenten zu bekämpfen, scheint bei Menasse nicht aufzukommen – er nimmt die antidemokratische Gesinnung von Teilen der Gesellschaft anscheinend als Fatum an. Er kommt zu dem Schluss, »dass die klassische Demokratie, ein Modell, das im 19. Jahrhunderts zur vernünftigen Organisation von Nationalstaaten entwickelt wurde, nicht einfach auf eine supranationale Union umgelegt werden kann, ja sie behindert. Demokratie setzt den gebildeten Citoyen voraus. Wenn dieser gegen die von Massenmedien organisierten Hetzmassen nicht mehr mehrheitsfähig ist, wird Demokratie gemeingefährlich.« Statt die Bildung des Citoyens hin zum Widerstand gegenüber Hetzkampagnen zu forcierten, wird dieser bequemerweise entmündigt. Freilich alles nur zu seinem Glück, wie Hans Magnus Enzensberger dieses Prinzip treffend charakterisiert: Die Europäische Union gibt sich »erbarmungslos menschenfreundlich. Sie will nur unser Bestes. Wie in gütiger Vormund ist sie besorgt um unsere Gesundheit, unsere Umgangsformen und unsere Moral. Auf keinen Fall rechnet sie damit, daß wir selber wissen, was gut für uns ist; dazu sind wir ihnen in ihren Augen viel zu hilflos und zu unmündig. Deshalb müssen wir gründlich betreut und umerzogen werden.«
Jürgen Petersen: Repräsentation in Demokratien
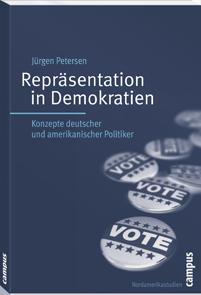
Repräsentation in Demokratien
»Der Kern moderner Demokratien ist die Repräsentation«. So steht es auf dem Rückdeckel des Buches »Repräsentation in Demokratien«. Aber was bedeutet das? Wie verstehen die Repräsentanten ihre Repräsentation? Wem gilt sie? Nur den Wählern oder gar allen, die sich im geografischen Bereich des Repräsentanten befinden? Welcher Art und welchen Inhaltes sind die handlungsstrukturierenden Konzeptionen von Repräsentation in demokratischen Systemen? Und: Gibt es Unterschiede zwischen den Repräsentationsmodellen beispielsweise in Deutschland und den USA?
Der Autor Dr. Jürgen Petersen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt und Research Associate am dortigen Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF). Er versucht diese Fragen zu beantworten und bedient sich dabei eines denkbar einfachen Mittels: der Befragung. Dabei steht er vor dem Dilemma, ebenfalls ein repräsentatives Ergebnis vorzulegen, was er durchaus thematisiert, wenn auch nicht ganz überzeugend (dazu später).
Zwischen Nichtbeachtung und Heldentum: Der Soldat und die (europäische) Demokratie
Den Wandel des Soldatenbildes innerhalb der europäischen Geschichte (inklusive eines bundesrepublikanischen Schwerpunkts) hat Claude Haas in der letzten Ausgabe der Zeit erhellend dargelegt. Und dort wo er geendet hat, gilt es weiter zu gehen. Man muss seine Betrachtung, die etwas abrupt schließt, und wesentliche Fragen aufwirft, fortspinnen, und erweitern, generalisieren: Wie ist das soldatische „Handwerk“, dieser Beruf in Zeiten eines weitgehend geeinten Europa, jenseits eindeutiger Bedrohungs- und Konfliktszenarien, zu beurteilen? Wollen wir es beurteilen? Wir, d.h. die Politik muss es, sollte es. Die Frage warum man am Hindukusch steht, benötigt eine klare Antwort. Man ist sie den Hinterbliebenen schuldig, und dem Bürger.
Kriege führen, für den Frieden (Popper). Gehen wir davon aus, dass es gerechte Kriege gibt, lassen wir Verteidigungsszenarien und die Abwehr von Aggression außen vor, und ebenso Kriege als bloße Fortführung, als Mittel der Politik, der Macht. Welche Aufgaben haben Soldaten dann zu erledigen, welche gerechten Kriege auszufechten, wenn wir davon ausgehen, dass sie dafür in ihrer Heimat nicht benötigt werden?
Robert Habeck: Patriotismus – Ein linkes Plädoyer
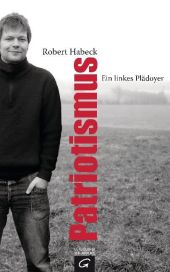
Die Feindschaft zum Staat als Repressionsinstanz, »Atomstaat«, »Bullenstaat«, als paternalistischer Akteur, Hüter fauler Kompromisse, verstellte den grünen Blick darauf, was (mit einem) geschehen würde, wenn man selbst zu dem gehörte. Der zivile Mut wollte immer über den Staat hinaus, zielte auf die Idee eines Gemeinwesens ohne Staat. Als dann rot-grün 1998 an die Regierung kam, waren die liberalen Vorstellungen von Gemeinwohl nicht mehr gegen, sondern mit dem Staat durchzusetzen. Auf diesen Schritt waren die progressiven Kräfte schlecht vorbereitet und sind es bis heute.
Hart geht Robert Habeck, 41, Fraktionsvorsitzender der Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag, mit der Linken im Allgemeinen und seiner Partei im Besonderen ins Gericht (womit die politische Richtung und nicht dezidiert die Partei »Die Linke« gemeint ist). Nach rot-grün, so Habecks These, habe das Land in einer Großen Koalition, die ihre Chancen leider (!) sträflich verpasst habe, vier Jahre verloren.
Lethargokratie, Staatsverschuldungsbeschleuniger und Semisozialismus
Peter Sloterdijk und die deutsche Politik
Eine irgendwie öde Diskussion, die da seit einigen Monaten (insbesondere von der ZEIT, aber auch in der FAZ) am Köcheln gehalten wird. Kern der Auseinandersetzung ist Peter Sloterdijks Artikel »Die Revolution der gebenden Hand« (allerdings auch einige Kapitel aus dessen Buch »Du musst dein Leben ändern«). Axel Honneth glaubte daraufhin nun Sloterdijk angreifen zu müssen, in dem er ihn – grob verkürzend – in durchaus altlinker Manier als Neu-Rechten und/oder wirtschaftliberalen denunziert, der irgendwie blind für die Bedürfnisse von Hartz-IV-Empfängern ist. Es gab einiges Feuilleton-Geplänkel und sogar eine brillante, aber schwer verständliche Verteidigungsrede von Karl-Heinz Bohrer in der FAZ.
Aber Sloterdijk wäre nicht Sloterdijk wenn er nicht zu einer Art Befreiungsschlag ausgeholt hätte; abgedruckt in »Cicero« mit dem ambitionierten wie provokativen Titel »Aufbruch der Leistungsträger«.
Ilija Trojanow / Juli Zeh: Angriff auf die Freiheit

Wenn man die ersten Seiten dieses Buches liest, kann einem tatsächlich angst und bange werden. Man glaubt in einem totalen Überwachungsstaat zu leben oder auf ihn fast zwangsläufig, ohne Rettung, zuzusteuern. Das Muster, welches die Autoren dabei verwenden, ist bekannt: Vom Einzelfall wird auf das Allgemeine geschlossen. Da vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 von Demonstranten Geruchsproben genommen und archiviert wurden, wird suggeriert, dies sei allgemeine polizeitechnische Praxis. Dass es sich beispielsweise in Hamburg um insgesamt zwei Fälle handelte, bleibt natürlich außen vor (genau wie die anschließende Diskussion um diese inakzeptable Vorgehensweise).
Da werden, so die Behauptung, die Fingerabdrücke auf meiner Kaffeetasse umgehend allen sogenannten Anti-Terror-Behörden gemeldet (falls sie nicht schon längst bekannt sind). Die Möglichkeit, dass private E‑Mails abgefangen und gelesen werden können, führt zu der Feststellung, dass jede verschickte E‑Mail einem unverschlossenen Brief gleicht, der weltweit von jedem Interessierten mit Internetzugang eingesehen werden kann. (Als »Begründung« heißt es lapidar, dass fast alle Browser…Sicherheitslücken haben.) In diesem Zusammenhang auf den guten, alten Brief als Geheimniswahrer zu verweisen, erscheint schon sehr komisch – als könnte nicht jeder Brief ebenfalls geöffnet werden. Wohl gemerkt: kann. Aber man liest unwillkürlich: wird.
Hubertus Buchstein: Demokratie und Lotterie
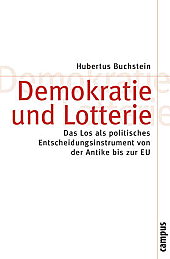
Der Untertitel macht neugierig: »Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU« heißt es da. Das Los als Entscheidungsinstrument kennt man eher im Sport. So werden in Fußballwettbewerben Spielpaarungen zugelost, wenn nicht jeder gegen jeden spielen soll. Meist wird es mit einer Mischung zwischen notwendigem Übel und willkommener Ungewissheit betrachtet. Der Zufallscharakter wird insbesondere von den vermeintlich besseren Mannschaften als wettbewerbsverzerrend empfunden, da schwächere Mannschaften durch entsprechendes »Losglück« begünstigt werden können; die Floskel vom »schweren« oder »leichten« Los macht dann oft die Runde. Das Weiterkommen in einem Wettbewerb wird unter Umständen nicht mehr alleine der Leistung (im Sieg über die zugeloste Mannschaft) gutgeschrieben.
Aber wäre es mit unserem Verständnis in Übereinstimmung zu bringen, politische Entscheidungen mindestens teilweise über Losentscheidungen vornehmen zu lassen? Ist nicht der Status des Gewählten für einen Amtsträger erst DIE Legitimationsbasis überhaupt? Wie würde ein »ausgeloster« Abgeordneter, Richter oder Bürgermeister akzeptiert werden? Geht es überhaupt darum, die Wahl durch das Los zu ersetzen? Oder könnten Losentscheidungen nur flankierende Maßnahmen zur rascheren Auswahl von Entscheidungsträgern darstellen? Worin könnten die Vorteile gegenüber den bisherigen Verfahren liegen?
