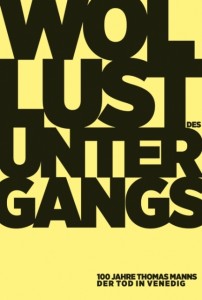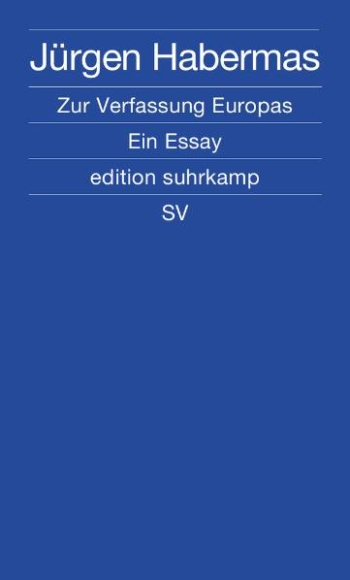Gefunden werden
Die archäologische Obsession erkläre ich mir so: sie ist die Sehnsucht, endlich alles hinter sich zu haben, Jahrtausende zwischen der peinlichen, lächerlichen, nichtsdestotrotz unerträglichen Misere des So-zu-Tuns-als-ob-man-lebte und dem offensichtlich unerwünschten Selbst zu wissen. Man wäre dann unerreichbar für die notorischen Lebensbejaher und die Tu-dir-was-Gutes-Missionare, sogar wenn sie gleich im Grab nebenan lägen. Vor allem wäre der Akku ihrer Handies korrodiert und endlich, endlich Ruhe.
Dann würde ich vielleicht ausgegraben von jemandem, der sich für das interessiert, was an mir am wenigsten wertvoll war und daher übrigblieb. Mit Samthandschuhen würde jener Jemand mein Wertlosestes berühren. Er wird. Er wird ein Leben für mich erfinden, das mein tatsächliches auch dann noch übertreffen würde, wenn es ein überdurchschnittlich schönes gewesen wäre. Mein Name wird zumindest so etwas wie »XX-Prinzessin« enthalten (der »XX«-Teil ist allerdings unberechenbar). Dafür werde ich das Glotzgeäuge an der Museumsvitrine stoisch über mein Gerippe ergehen lassen; im Leben gab es durchaus Blöderes zu ertragen.
Der Archäologe wird mich finden, wie mich kein Zeitgenosse jemals finden könnte. Er wird glücklich sein über das Wenige, das ich noch sein werde, anstatt nur Unzulänglichkeiten zu bemängeln an dem beträchtlichen Haufen diversen Materials und Feinstoffs, der ich lebend bin.
Meine einzige Arbeit besteht darin, herauszufinden, wohin ich mich legen muss, damit er mich finden wird. Ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende können die Topographie ziemlich verändern, es kommt also darauf an, in der richtigen geologischen Schicht zu expirieren. Wenn ich manchmal einen Zweifel schiebe, dann diesen: ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gefunden werden will. Es soll nur vorerst einmal einfach irgendwie aufhören.
9. Januar 2009
Nein, finden
Sich in eine geologische Schicht legen, um von einem Archäologen des 4. Jahrtausends ausgelocht zu werden, so ein Quatsch! Weiterlesen