
Anton Hunger: Blattkritik


Es ist wohl so etwas wie ein Sinnbild: Wenn man nach vielen Jahren noch weiß, wann und wo man die Bücher eines bestimmten Autors, einer bestimmten Autorin gelesen hat. Und wie es einem danach ging. Dabei kommt es nicht unbedingt darauf an, wieviel man aus dem Buch tatsächlich »behalten« hat. Sondern nur, wie man sich dieses Buch erlesen hat. Und mit welchen Bildern man herumläuft, wenn man den Titel oder den Autor hört oder liest.
Ich weiß heute noch, wie ich Hermann Lenz’ Eugen Rapp-Romane gelesen habe. Ich sehe mich mit dem eher modrig duftende Exemplar von »Neue Zeit« aus der Stadtbibliothek auf dem Bauch lesend. Und staunend. Später dann das fast protokollhafte, für Lenz’ Verhältnisse zornige »Seltsamer Abschied«, in dem sein Alter ego Eugen Rapp durch seiner Schwester übel mitgespielt wird, die ihn nach dem Tod der Eltern aus dem Haus treibt, in der Rapp mit seiner Frau gelebt hatte. Rapp, der mit Hermann Lenz einerseits identisch, andererseits aber auch eine Kunstfigur ist, trauert ob dieser Vertreibung vom heimeligen Stuttgart ins hektische München (seine Frau hat dort ein Haus und sie ziehen dort ein) in der ihm eigenen Mischung aus Melancholie, Gleichmut und Ergebenheit. Irgendwann habe ich mir die Bücher dann gekauft. So etwas wollte ich besitzen.
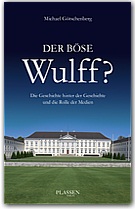 Vor einem Jahr trat Christian Wulff vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Über mehr als zwei Monate prasselte damals das mediale Dauerfeuer auf einen amtierenden Bundespräsidenten ein. Michael Götschenberg, Leiter des Hauptstadtbüros von RBB, MDR, Radio Bremen und des Saarländischen Rundfunks, bemüht sich in seinem Buch »Der böse Wulff?« aber nicht nur um die Aufarbeitung der diversen Wulff-Affären (die gelegentlich auch nur lächerliche Affärchen waren), sondern untersucht die Umstände vor bzw. bei der Wahl Wulffs und gibt einen Überblick über die 598 Tage der Präsidentschaft. Dabei zieht er was die Amtszeit angeht ein überaus positives Fazit und mag so gar nicht in die negativen Stimmen der Journalistik einstimmen, die, wie man heute nachlesen kann und Götschenberg auch zeigt, durch die Dynamik der Umstände eingefärbt waren (und immer noch sind).
Vor einem Jahr trat Christian Wulff vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Über mehr als zwei Monate prasselte damals das mediale Dauerfeuer auf einen amtierenden Bundespräsidenten ein. Michael Götschenberg, Leiter des Hauptstadtbüros von RBB, MDR, Radio Bremen und des Saarländischen Rundfunks, bemüht sich in seinem Buch »Der böse Wulff?« aber nicht nur um die Aufarbeitung der diversen Wulff-Affären (die gelegentlich auch nur lächerliche Affärchen waren), sondern untersucht die Umstände vor bzw. bei der Wahl Wulffs und gibt einen Überblick über die 598 Tage der Präsidentschaft. Dabei zieht er was die Amtszeit angeht ein überaus positives Fazit und mag so gar nicht in die negativen Stimmen der Journalistik einstimmen, die, wie man heute nachlesen kann und Götschenberg auch zeigt, durch die Dynamik der Umstände eingefärbt waren (und immer noch sind).
Siebenmal kommt das Wort »Diskurs« im Text von Uwe Kammann, dem Direktor des Grimme-Instituts, vor, in dem er die Nominierung des »Dschungelcamps« in der Kategorie Unterhaltung verteidigt. Es ist ein merkwürdiger Diskurs, der hier fast beschworen wird: »…die Stärke des Grimme-Preises ist nicht allein die hohe Qualitätskonstanz bei der Auswahl, sondern sie besteht auch und vor allem im Diskurs über eben diese Qualität.« Was Kammann darunter versteht, kommt gleich danach: Rund »60 renommierte, unabhängige Personen« beraten »über sieben Wochen das Gesamtangebot eines Fernsehjahres«. Wie gut, dass da schon die Adjektive »renommiert« und »unabhängig« stehen, das entlastet den Leser von der eigenen Prüfung. Merkwürdig, dass die Mitglieder der Nominierungskommissionen deutlich weniger als 60 sind. Und wer da »unabhängig« und/oder »renommiert« ist, möge jeder selber entscheiden.
Der »Diskurs« findet also in den Gremien des Grimme-Preises statt. Der öffentliche Diskurs findet also frühestens erst nach dem Ereignis (= Nominierung) statt. Er ist somit »nur« als Kritik möglich. Einen direkten Einfluss hat das Publikum nicht. Das ist meines Erachtens auch nicht das Problem. Es galt ja bisher als ein Markenzeichen des Grimme-Preises eben nicht nach Quoten und Marktanteilen zu schielen und seine Entscheidung unabhängig davon zu treffen. Es ging, so die Idee, um »Qualität«. Hierauf geht Kammann auch ein, in dem er eine »Qualitätskonstanz« bei den Nominierungen ausmacht. Das muss er natürlich unterstellen, weil es ansonsten die Preise ad absurdum führen würde. Und hieran entzündet sich ja auch die Kritik. Die gab es reichlich. Kammann fühlt sich berufen, die Nominierung, die »einstimmig« erfolgte, zu verteidigen. Das ist gut so, weil dieser Text mehr zeigt, als zehn Grimme-Preise aussagen könnten.
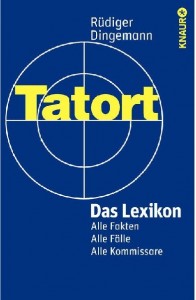
Der Essay aus dem Printbuch wurde ein bisschen verändert, kleinere Korrekturen angebracht und die Zwischenüberschriften wurden zu eigenen Kapiteln. Es gibt immer noch eine Zeitreise in die »Tatort«-Geschichte mit zahlreichen Kuriositäten. Hervorgegangen aus der »Stahlnetz«-Reihe, die sich, im Gegensatz zu den »Tatort«-Folgen, an Originalfällen orientierte, sollte eine Art Gegengewicht zur seit 1968 im ZDF erfolgreichen Krimireihe »Der Kommissar« geschaffen werden. Der Gedanke, den Föderalismus an diversen Schauplätzen mit unterschiedlichen Ermittlern zu spiegeln, erwies sich, so Dingemann, als Glücksgriff.
An die durch drei Punkte gekennzeichnete Leerstelle lassen sich, je nach Grad der politischen Extrapolation, verschiedene Worte setzten: Bundesheer, Sozialdemokratie/Volkspartei, große Koalition, Österreich; — die jeweils vorangehende Bezeichnung als pars pro toto der nachfolgenden.
Ich entnehme diesen Überlegungen, die nichts anderes sind als Feststellungen des Offensichtlichsten (über das man nach wie vor wenig spricht), zwei Punkte, die ich ein wenig weiterspinnen will. Erstens, auf den Pornoseiten und den sogenannten Gesellschaftsseiten, in den social networks, wie es euphemistisch heißt, kann man Amateuraufnahmen von Amateurspielern sehen, doch bei weitem nicht in so großer Zahl, dass sie neben dem professionellen Pornogeschäft ins Gewicht fallen. Es ist dies ein Zeichen dafür, das öffentlicher und privater Bereich auch auf der intimsten Ebene nicht mehr getrennt sind. Eine nicht unbedeutende Rolle dafür spielt die Tatsache, dass Reproduktionsinstrumente, also Kameras aller Art, heute infolge technischer Entwicklungen, der allgemeinen Konsumgier und des faktischen Wohlstands für jedermann zugänglich sind. Jeder kann ständig Abbildungen von sich und seinen Nächsten machen und übertragen und tut es auch. Ein Kind, das kein Handy mit Fotoapparat besitzt, kann neben seinen Freunden nicht bestehen. Ein Kind ohne Internetanschluss kann auch nicht bestehen. Mimesis, Spiegelung, ist ein Massenphänomen und eine Massenzwangsneurose geworden. Zugleich können bei weitem nicht alle Personen vor den Schönheits- und Geilheitsidealen bestehen. Es findet eine Auslese statt. Die dabei entstehenden Kränkungen werden durch sekundäre, passive, virtuelle »Aktivitäten« in der Welt des Scheintods kompensiert.
Immer häufiger höre ich von ihr: der »Netzgemeinde«. Es wird an sie appelliert, über sie philosophiert, gegen sie polemisiert oder mit ihr argumentiert. Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff wohl Leute, die sich in Blogs, auf Twitter und/oder Facebook melden, austauschen und koordinieren. Oberflächlich betrachtet gehöre ich also auch dazu. So wird man vereinnahmt. Zu den guten Vorsätzen einiger selbsternannter Sprecher dieser sogenannten Netzgemeinde gehörte es offensichtlich, das inzwischen träge gewordene Volk aufzurütteln. Da ist dann auch schnell von der »Krise der Blogger« die Rede. Und das dann ausgerechnet aus der Krawallfabrik »Freitag«, die vom »Neobiedermeier« der Internet-Couch-Potatoes schwafelt, die sich lieber in den Mauern des »Club Robinson« à la Google+ und Facebook tummeln. Als Referenzgrößen dafür dienen jene, die mit Verträgen bei den »Altmedien« ausgestattet sind. Dabei habe ich längst aufgegeben diese Sektenführer zu lesen, da sie mir schon vor Jahren außer selbstreferenziellem Wortgeklingel nichts zu sagen hatten. »Spiegel Online« reicht das heute immer noch. Was einiges über dieses Medium verrät.